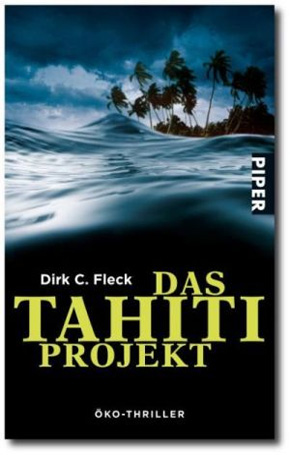Er ging auf phantastische Weise aufrecht, als würde ihn ein Engel am Band führen. In der Hand jonglierte er einen weißen Spazierstock mit goldenem Knauf. Die gepflegten Rastalocken fielen auf den Samtkragen seines langen schwarzen Mantels, und unter der hohen Stirn blitzten Augen von solcher Klarheit, dass man glauben mochte, der Erlöser selbst habe im Sündenpfuhl Einzug gehalten. In seinem Gefolge schlenderten vier Jünger über die Brücke am Voorburgwal, jeder für sich ein Star, aber keiner nur annähernd mit jener Strahlkraft ausgestattet, wie sie dieser braune Prinz zur Schau trug. Er merkte, dass mich seine smarte Darstellung eines Zuhälters und Drogenbosses beeindruckte. Er schenkte mir sein strahlendstes Lächeln. Natürlich hatte er einen Diamanten im Schneidezahn...
Es war die Zeit der Metamorphose im Amsterdamer Redlight District. Die roten Vorhänge in den schmalen, sich der Straße zu neigenden Häuser begannen sich nach und nach zu öffnen. Lieferwagen rückten ab, Baustellen wurden geschlossen. Der geschäftige Alltag zog seine Finger zurück und überließ das Terrain den Tätern und Opfern, den Begierigen und den Raubrittern. Dealer und Taschendiebe formierten sich an den strategisch wichtigen Stellen wie Geier.
Ich drehte eine erste Runde, um mir ein Überblick zu verschaffen, wo ich nach Julia zu suchen hatte. Bei Tage wirkt die Keimzelle Amsterdams mit ihren engen Gassen, mit ihren Grachten und Brücken wie ein Anachronismus, ein Pfahl im Fleische der Moderne. Dann besitzt sie die Autorität des Historischen, die schlagartig verloren geht, sobald die Neonzeichen erglühen und die Musik aus den Coffeshops dröhnt. Wenn die Touristenbusse kommen, verwandelt sich das gewachsene Ambiente rund um die Oude Kerk in eine absurde Puppenstube der Lust. Plötzlich verströmt das Viertel diesen mittelalterlichen Lebkuchencharme, der die menschliche Ur-Sünde in einer Art Zuckerguss zu konservieren scheint. Trotzdem war den Touristen nicht wohl bei der Ankunft. Sie bildeten kleine Pulks, als suchten sie den Schutz der Herde, während die Taschendiebe bereits um sie herumtänzelten.
Wer Zeit hat, sich auf dem buckeligen Kopfsteinpflaster an die besondere Gangart des Viertels zu gewöhnen, wird bald dieses gläserne Ticken im Ohr haben. Es ist das Geräusch, das die Ringe der Mädchen auf den Fensterscheiben machen. Die Freier, die dieses Ticken auslösen, rekrutieren sich aus fünf Männertypen: dem gutsituierten Angestellten im Trench, Hände in den Taschen, hier und dort ein Preisangebot einholend; dem Spanner, der in respektierlichem Abstand zu den Fenstern bleibt und die Mädchen aufreizend langsam mit den Augen beleckt; dem jungen Hüpfer, der seinem Freund imponieren möchte, welcher schüchtern an der nächsten Ecke wartet; natürlich sind auch die internationalen Proleten in ihren senffarbenen Lederjacken vor Ort. Und schließlich die Träger der schweren Traurigkeit: Männer, die verlassen wurden oder die Last einer unerfüllten Sehnsucht mit sich herumschleppen. Sie sortieren das Angebot wie in einem Pralinenladen.
The Girls In The Windows, wie sie dem Besucher an den Hotelrezeptionen als Attraktion empfohlen werden, spiegeln wider, was sich Holland in den Ländern, wo der Pfeffer wächst, unter den Nagel gerissen hat. Die Frauen sind nicht nur jung und schön, sie wissen auch zu animieren. Dabei agieren sie zwischen schüchternem Verlangen und lustvoller Zuneigung, ohne dass Routine erkennbar wäre. Sie hocken in rot beleuchteten engen Zellen, ausgestattet mit einem Bett und einem Waschbecken, unter dem sich bald nach Dienstbeginn eine feuchte Lache in die Auslegeware frisst.
Wenn sich in der Dämmerung die Mäntel und Jacken der Gaffer am Rauputz der Wände scheuern, wenn der Verkehrslärm spürbar anschwillt, wird der Gulden vergoldet. Bis zu zweitausend pro Schicht streicht so ein Freudenmädchen für ihren Zuhälter ein. Und die Freier, die ihre Favoritin hinter vorgezogenen Gardinen noch in anderen Händen wissen, hocken beim Bierchen im Amsterdamned, im Dreadlock, der Loading Zone oder im Bulldog. Hier warten sie, dass die Kleine endlich fertig wird. Das regelmäßige Glockenspiel der mächtigen Oude Kerk, um die die Wohnkäfige der dunkelhäutigen Transvestiten gruppiert sind, scheint der ganzen Angelegenheit ihren Segen zu geben.
Im Morgengrauen, als das Wasser in den Grachten wie gebügelt da lag, als die Betrunkenen stieren Blickes davon wankten, als schließlich nur Geschöpfe mit Schorfwunden übrig blieben, überkam mich die Ernüchterung wie etwas, das im Preis der Nacht inbegriffen war. "Opruiming! Alles moet weg!“ stand im Schaufenster einer Lederboutique neben dem Grand Hotel Krasnapolski, dessen Eingänge seit langem vernagelt sind. Die besseren Herrschaften wohnen nicht mehr in diesem Viertel. Sie kommen gelegentlich zu Besuch, inkognito versteht sich. Dann benehmen sie sich, als sei das Leben eine einzige zu unterschreibende Quittung. Ich hatte Julia nicht gefunden. Sie hat sich nie wieder bei mir gemeldet.
Dieser Artikel erschien im MERIAN-Heft Amsterdam, das ich als Heftredakteur betreut habe.
Das Publikum im Theater des Casinos von Estoril ist gekleidet wie auf dem Wochenmarkt. Und doch knistert es in den Reihen vor freudiger Erwartung. Die Menschen sind gekommen, um ihrer Ikone zu huldigen: Amalia Rodrigues! Bereits drei Jahre nach ihrem Tod im Jahre 1999 war der Göttin des Fado mit dem Musical „Amalia!“ ein Denkmal gesetzt. Seitdem steht es den Portugiesen als Tränke zur Verfügung, an der sie ihre Sucht nach Sehnsucht vorübergehend stillen können.
Das Stück wird von Beginn an in warme Applauswatte gepackt. Am Schluß reagiert die Masse wie ein Schwarm tropischer Fische, der einen elektrischen Impuls kollektiv pariert. Wenn sich tausend Menschen impulsiv erheben, um einen komplizierten Rhytmus zu klatschen, der den herzzerreißenden Abgesang Amalias wie ein Fangnetz unterlegt, wird selbst dem adrett gekleideten Besucher aus der norddeutschen Tiefebene klar, dass Fado Volksmusik ist.
Die S-Bahn von Estoril nach Lisboa sollte ins Weltkulturerbe eingehen. Wo sonst darf man eine schnatternde Schar geschminkter junger Mädchen auf dem Weg in die Disco bis ins Herz der Stadt begleiten und dabei den parallel laufenden Atlantik in die Tejomündung branden sehen? Es ist meine erste Nacht in Lissabon. An der Endstation Cais do Sodre ziehe ich es vor, den entgegengesetzten Weg am Tejo einzuschlagen, als meine aufgekratzten Mitreisenden. Nach einiger Zeit verfinsteren sich die Straßen, nur vor den Eingängen der Cafes liegen grelle Neonbahnen aus.
Ich steige eine schmale Steintreppe zwischen zwei Häuserwänden hinauf, auf denen die schabenden Schultern meiner Vorgänger helle Spuren hinterlassen haben. Ohne es zu ahnen bin ich in die Alfama geraten, Lissabons ältestem Stadtviertel. Niemand begegnet mir auf den ausgetretenen Pfaden. Es ist ein regnerischer Dienstag im Januar, die Alfama atmet durch ihr Mauerwerk, das ohne die Touristenschwärme im Gedärm zu alter Autorität findet. Die geschlossene Stadt trägt schwarz in dieser Nacht, selbst die Straßenlaternen halten sich im Erhellen des Mysteriums zurück.
Die Rua de Sao Pedro mündet gegenüber dem Fadomuseum in einen schmucklosen Platz. Einige Häuser sind in Plastikbahnen verhüllt. Als eine Böe an ihnen zerrt, entdecke ich dahinter einen beleuchteten Eingang, in dem eine stolze Dame sitzt. Wie ferngesteuert bewege ich mich auf sie zu. Mit einer Handbewegung gibt sie das Lokal zur Besichtigung frei. Ich schreite unter der gewölbten Decke zwischen gedeckten Tischen an einer gekachelten Gemäldegalerie entlang. Zwei Männer unterhalten sich an einem Tisch mit einer Frau. Sonst sind keine Gäste hier. Die Kellnerin teilt mir mit, dass Argentina mich auf einen Portwein einladen möchte. Ich setze mich, als zwei Herren vor mir an der Säule Platz nehmen. Der eine hält eine portugiesische Gitarre in Händen, der andere eine spanische. Die portugiesische Gitarre wirft einige spielerische Kaskaden aus, die den Raum erkunden und beim heruntertropfen vom Rhythmus der spanischen Kollegin virtuos aufgefangen werden. Ich proste Argentina Santos zu, die eine bedeutende Fadosängerin gewesen ist und jetzt über ihren Tempel wacht, dem Parreirinha de Alfama.
Ein Mann im schwarzen Anzug nähert sich gesenkten Hauptes und mit gefalteten Händen von der Bar. Er schließt die Augen und beginnt Musik zu inhalieren. Mit jedem Atemzug hebt sich der Kopf. Er preßt einen glockenhellen Ton aus der Körpertube, der sich im Klanggespinst der Gitarren die Hörner abstößt. „Erbaue, Lydia, nichts in jenem Raume, der dich die Zukunft dünkt/ Erfülle dich ohne zu warten/ Du selbst bist dein Leben/ Verfüg nicht über dich, als gäbs ein Morgen/ Wer weiß, ob dir das Schicksal nicht den Abgrund vorbestimmt“.
Beim ausklingen des letzten Wortes breche ich in Beifall aus. Argentina lächelt. Die Portugiesen, das wußte ich nicht, ertränken das letzte Wort immer in Applaus, auf diese Weise weben sie dem Fado ihre Begeisterung an, werden sie Teil seiner Poesie. Während der Darbietung herrscht absulute Aufmerksamkeit, wer mit dem Nachbarn tuschelt, den strafen Blicke wie Elektroschocks. Ist es nicht herrlich, dass Poesie in der Lage ist, dem Pöbel Grenzen aufzuzeigen? Bei Argentina Santos befinde ich mich zum erstenmal in siegreicher Gesellschaft.
Meine Absätze hallen auf den elfenbeinfarbigen Moisaikbahnen der Baixa wider. Dies ist das Reich der calceteiros, der Steinsetzer, die mir heitere Kalligrafien aus Blaubasalt in den Weg gehämmert haben. „Ihr Ausländer denkt vielleicht, dass Fado und Saudade etwas sehr Schmerzhaftes, ja Trauriges ist,“ hatte Misia kürzlich in einem Interview gesagt. Amalia selbst hatte Misia zu ihrer legitimen Nachfolgerin ernannt. „Aber für uns Portugiesen ist Saudade ein angenehmes Gefühl. Saudade ist nicht nur Nostalgie, nicht nur das Aroma von längst Vergangenem oder frisch Verwehtem, Saudade ist ein Versprechen. Etwas, was nicht sterben kann. Ich glaube, dass man im Fado eine hohe Spiritualität erreichen kann.“
Surpresa Natural - Wanderungen und Ausflüge in und um Cascais in Portugal!
Malin zuckte erschrocken zusammen, als sich der Intercity mit dumpfen Knall in den Wirbel eines entgegen kommenden Zuges warf. Kurz darauf aber fand der Zug aus kurzer Erschütterung wieder in seinen schwebeartigen Zustand zurück. Langsam, wie bei einem Aderlass, wich der Schreck aus Malins Gliedern. Am Fenster raste fauchend ein endloses braunes Band vorbei. Als sich seine Augen zu gewöhnen begannen, lehnte er sich an die Scheibe und sah so weit es ging voraus. Er konzentrierte sich auf einen Wagon in der Ferne und versuchte nun, ihn so lange wie möglich im Auge zu behalten, was nicht immer gut gelang, da sie ihm rasend schnell entzogen wurden. Nach drei, vier Versuchen hatte er immerhin heraus gefunden, dass es sich um Viehwagons handelte, ihm war sogar, als hätte er einem in die Gitterstäbe geklemmten Schwein in die Augen gesehen. Malin lehnte sich zurück. Erst jetzt bemerkte er, dass die Aufzeichnung weiter gelaufen war, dass sie sich lediglich wie eine Kuchengabel unter die Torte der greifbaren Realität geschoben hatte. Er drückte die Ohrstöpsel zurecht und lauschte wieder dieser hilflosen Stimme. Sie tat ihm leid, sie wusste nicht, für wen sie sprechen sollte. Es stand kein Mensch hinter ihr, der sie mit seinen Gefühlen hätte fordern können, hinter ihr stand das sprachlose Monster der Unschuld: SS-Unterscharführer Gerhard Schneider, vernommen und auf Band festgehalten während der Frankfurter Auschwitzprozesse im Jahre 1964.
„Sie sind angekommen in Viehwagons, immer drei- bis viertausend Menschen, alle aus Warschau. Dazwischen sind aber auch noch Züge gekommen von anderen Orten, die hat man, weil die Stalingradoffensive im Gange war, hat man die Judentransporte an einem Bahnhof stehen lassen. Und noch dazu vielfach in französischen Wagen. Die waren aus Blech, also so, dass es war, dass in Treblinka angekommen sind fünftausend Juden und davon waren dreitausend tot. Ausgeladen hat man Halbtote und Halbwahnsinnige. Die Toten hat man aufgeschichtet. Aufeinandergeschichtet, so hoch. An der Rampe. Die waren aufgeschichtet wie Holz.“
Eine Dame gesellte sich zu Malin ins Abteil. Sie trug ein leichtes, geblümtes gelbes Sommerkleid und weiße Handschuhe. Sie nickte kurz und nahm ihm gegenüber am Fenster Platz.
„Der erste Eindruck in Treblinka für mich und meine Kameraden war katastrophal. Weil man uns nicht gesagt hat, wie und was, dass dort Menschen getötet werden, das hat man uns nicht gesagt. Man hat gesagt, der Führer hat Umsiedlungsaktionen angeordnet, das ist ein Führerbefehl, verstehen Sie? Man hat nie gesagt töten. Na, dann hat uns der Spieß, hat uns das Lager gezeigt. Und als wir hinauf kamen gingen gerade die Türen auf von der Gaskammer und die Menschen fielen heraus wie Kartoffeln.“
Malin drückte die Stopptaste. Ihm zur Seite schwang sich eine Hochspannungsleitung in eleganten Sätzen durch die Landschaft, die Weiden waren mit Kühen besprenkelt, welche wiederkäuend im Matsch lagen. Seine Begleiterin hatte die Augen geschlossen, das einfallende Sonnenlicht wärmte ihren Schoß. Sie atmete tief und regelmäßig, als hielte sie die Zügel ihres Tagtraums fest in der Hand.
Er verließ das Abteil und zündete sich auf dem Gang eine Zigarette an. Der Zug legte sich in die Kurve. Das Lichtquadrat kroch von den Oberschenkeln der Frau auf den freien Sitz neben ihr. Im gleichen Tempo, in dem die Beine in den Schatten gerieten, erlosch das Lächeln auf ihrem Gesicht, das sie in den letzten Minuten so betörend zur Schau gestellt hatte. Es kehrte erst wieder, als die Sonne günstig stand. Mit jedem Zentimeter, den sich das scharfkantige Lichteck auf dem textilen Blumenfeld zurück eroberte, schien die Frau aus ihrer kurzfristigen Starre zu erwachen. Malin sah der Wiedergeburt der schönen Unbekannten fasziniert zu – sie war hinter Glas ausgestellt, wie eine Ikone der Sinnlichkeit,. Als das warme Sonnengold zwischen ihre leicht gespreizten Beine fiel, warf sie den Kopf nach oben und öffnete die Lippen, als würde sie schreien. Er konnte den Schrei nicht hören aber er sah ihn. Für einen kurzen Moment begegneten sich ihre Blicke. Die Frau strich hastig ihr Kleid zurecht und drängte kurz darauf an ihm vorbei Richtung Speisewagen. Malin öffnete das Fenster und gestattete dem Wind, ihm peitschend in die Haare zu fahren. Als er an seinen Platz zurückkehrte, fühlte er sich von einem Duft umhüllt, wie ihn kein Labor der Welt herzustellen vermochte. Bevor er sich seine Ohrstöpsel einsetzte, inhalierte er die flüchtige Essenz wie ein Lebenselixier.
„Das waren die heißen Augusttage. Das Erdreich hat sich bewegt wie Wellen, durch die Gase. Der Geruch war infernalisch. Das hat furchtbar gestunken, dass man es kilometerweit, überall, je nachdem wie der Wind ging, so war der Gestank, verstehen Sie? Die Juden haben es geahnt, die haben es geahnt ... Sie waren vielleicht im Zweifel, aber manche werden es gewusst haben. Zum Beispiel waren jüdische Frauen, die haben ihren Töchtern in der Nacht die Adern geöffnet und sich selbst, andere haben sich vergiftet, weil sie doch das Rattern der Motoren von den Gaskammern gehört haben. Da war ein Panzermotor in dieser Gaskammer. In Treblinka hat man nur Auspuffgase genommen.“
Zwei elegante alte Herren in offenen Kaschmirmänteln öffneten die Tür zum Abteil. Ein kalter Hauch umwehte sie, ähnlich dem, den eine einfahrende U-Bahn in die Station drückt. Sie mochten um die achtzig sein, wuchteten ihre Koffer aber erstaunlich behände auf die Ablage. Malin blickte in ihre gebräunten, mit Altersflecken gesprenkelten Gesichter. Er hatte sich im Laufe der Jahre die Fähigkeit erworben, die Physiognomien der Menschen auf der Zeitspur sowohl nach vorne als auch nach hinten bewegen zu können. Hinter jeder Physiognomie steckte eine Mutterpflanze. Das wahre Gesicht sozusagen, das auf dem Schüttelrost der Zeit allerdings die aberwitzigsten Verrenkungen erfährt. Und diese Männer machten ihm Angst. Ihre blauen Augen, die gescheitelten silbergrauen Haare, die scharfkantig geschnittenen Kinn- und Wangenpartien legten sich in der Verjüngung wie eine deckungsgleiche Folie auf das Bild, das man sich hierzulande einmal vom Herrenmenschen gemacht hatte.
„Und da so viele Leute anfielen, lagen tagelang ganze Haufen von Menschen vor der Gaskammer. Unter diesen Menschen war eine Kloake, zehn Zentimeter hoch, Blut, Würmer, Dreck. Es wollte das niemand wegräumen. Die Juden, die haben sich lieber erschießen lassen und haben dort nicht arbeiten wollen. So gingen wir selbst hinauf und ließen Riemen schneiden, die hat man den Leichen um die Brust gelegt und hat sie weggeschliffen ...“
Malin drückte seine Schläfe gegen die Fensterscheibe, deren kühler Stempel ihm gut tat. Sie passierten den Bahnhof von Wittenberge, wegen Gleisarbeiten hatten sie das Tempo extrem gedrosselt. Er warf einen Blick in die tristen Straßen. Kinder hockten apathisch im Rinnstein, zerlumpte Gestalten mit Handwagen zogen stumm an ihnen vorbei, sie beachteten die toten Körper nicht, die auf den aufgeworfenen Gehwegen lagen. Die Menschen bewegten sich wie in Gelee gegossen. Aber plötzlich, als hätte man ihnen einen Stromschlag verpasst, flüchteten sie in Hinterhöfe und Hauseingänge, manche verkrochen sich in der Kanalisation. Kurz darauf bogen zwei Männer in schwarzen Uniformen um die Ecke, sie scherzten miteinander wie auf einem Sonntagsspaziergang. Vor der unbekleideten Leiche eines jungen Mädchens hielten sie an. Während der eine mit der Stiefelspitze gegen ihre Brust stieß, zog der andere seine Pistole und feuerte auf das letzte intakte Fenster in der Straße. Gelangweilt setzten sie ihren Weg fort. Hinter ihnen hoben sich die Gullideckel. DAS IST DIE LÖSUNG! stand auf einem Plakat.
In weniger als einer Stunde würde er Simon Goldstein gegenüber stehen. Der 97jährige war der letzte seiner Art, der letzte bekannte Überlebende eines deutschen Konzentrationslagers. Malin hatte es sich zur Aufgabe gemacht, die Geschichte dieses Mannes aufzuschreiben. Mit Goldstein würden die Opfer ihre letzte Stimme verlieren, aber jedenfalls sein Vermächtnis sollte erhalten bleiben.
„Sieh an,“ bemerkte einer seiner Reisebegleiter, „Schneider ist draußen!“ Er faltete die Zeitung mit der entsprechenden Meldung mehrmals zusammen und reichte sie seinem Gegenüber. Dann griff er in die Tasche seines Jacketts und setzte sich eine Sonnenbrille auf.
In Malins Ohren dröhnte es, als müsse ihm jeden Moment das Herz aus dem Halse springen. Er schnappte seine Tasche und mühte sich an den alten Männern vorbei auf den Gang. Auf dem Weg zum Speisewagen rempelte er mehrmals gegen die Abteiltüren, was ihm den einen oder anderen bösen Blick bescherte, besonders von den älteren Fahrgästen. Wer um Gottes Willen hatte dieser Generation bloß den Filter des Vergessens ins Gesicht gezogen?
Endlich erreichte er den Speisewagen. Ein Zweiertisch war frei, er musste erst kürzlich verlassen worden sein, denn weder Teetasse noch Eisbecher waren bisher abgeräumt worden. Unter der Zuckerdose lugte ein weißer Handschuh hervor. Malin zerknüllte ihn in der Faust und führte ihn an die Nase.
„Entschuldigen Sie,“ hörte er eine sanfte weibliche Stimme sagen, „haben Sie auf diesem Tisch zufällig einen weißen Handschuh gefunden?“
Er schüttelte den Kopf und verharrte in dem betörenden Duftbad, bis der Zug den Hauptbahnhof von Berlin erreichte.
Diese Kurzgeschichte erschien in dem Buch „Hinterland – 20 Erzählungen, inspiriert von der Musik David Bowies“ (2010 im Wurdack-Verlag, HG. Karla Schmidt)
Der Hoffmann und Campe Verlag bat zu einer Pressekonferenz, um ein Buch vorzustellen, von dessen Sorte es zwar schon einige gibt, die aber mit hoher Wahrscheinlichkeit in den nächsten Jahren Konjunktur haben werden. Titel des Buches: “Die kalte Sonne. Warum die Klimakatastrophe nicht stattfindet”, geschrieben von Fritz Vahrenholt und Sebastian Lüning. Moderiert hat diese Veranstaltung der umtriebige Stefan Aust, der als Chefredakteur des Spiegel einst dafür sorgte, dass ein Report über Windkraft, aus dem man durchaus den Schluss hätte ziehen können, dass Windkraft Sinn macht, gegen den Willen des Autors Harald Schumann in eine Geschichte umgeschrieben wurde, die eindeutig gegen diese Energieform Stellung bezog. Fritz Vahrenholt kenne ich recht gut, ich habe Hamburgs ehemaligen Umweltsenator für die Welt porträtiert, als er im Vorstand der Deutschen Shell saß. Sein Co-Autor Sebastian Lüning ist seit 2007 als Afrika-Experte beim Öl- und Gasunternehmen RWE Dea beschäftigt.
Diese beiden Herren behaupten nun folgendes: entgegen aller Prognosen ist die Erderwärmung seit über zehn Jahren zum Stillstand gekommen. Selbst bei steigenden CO2-Emissionen wird die Erwärmung in diesem Jahrhundert 2 °C nicht überschreiten. Die Erwärmungswirkung von CO2 ist überschätzt worden. Neueste Erkenntnisse zeigen, dass Ozeanzyklen und die Sonne, die kürzlich in eine längerfristige strahlungsarme Phase eingetreten ist, einen größeren Beitrag zum Klimageschehen leisten als bisher angenommen.
Ich möchte hier nicht darüber streiten, ob die Behauptungen richtig sind – wer bin ich, das zu beurteilen? Ich möchte lediglich darauf hinweisen, dass wir uns, was den Klimawandel angeht, inmitten eines Wissenschaftsstreits befinden. Und den Wissenschaftsstreit gibt es solange, wie es die Wissenschaft gibt. Wissenschaftlich lässt sich alles beweisen, notfalls auch, dass die Sonne eine Scheibe ist, eine kalte dazu. Wenn ich davon sprach, dass es solche Bücher wie die von Vahrenholt und Lüning in Zukunft häufiger geben wird, dann deshalb, weil das Bedürfnis nach Beschwichtigung in unserer Gesellschaft stark verankert ist. Wir würden uns angesichts der düsteren Aussichten nur zu gerne die Mitschuld daran nehmen und wer könnte uns besser Absolution erteilen als die Wissenschaft. Im Verein mit den Medien natürlich. Der BILD-Zeitung war das Erscheinen der "Kalten Sonne" eine dreiteilige Serie wert. Titel: "DIE CO2-LÜGE. Stoppt den Wahnwitz mit Solar- und Windkraft!" Spiegel-Online wiegelt ebenfalls in einem ellenlangen Artikel ab und es wird sicher nicht lange dauern, bis die Autoren der "Kalten Sonne" die vermeintliche Klimalüge in jeder Talkshow anprangern dürfen.
“Die kalte Sonne. Warum die Klimakatastrophe nicht stattfindet” ist ein Placebo. Selbst wenn es stimmen würde, dass die Erwärmungswirkung von CO2 überschätzt wurde, wird die Lebensweise, die den CO2-Überschuss produziert, in keiner Weise in Frage gestellt. Das Buch ist ein weiterer Freifahrtschein in die Sorglosigkeit, mit der wir uns auf ein höchst gefährliches Gleis begeben haben. Also urinieren wir munter weiter in unser Wohnzimmer. Anstatt aber unsere Lebensweise in Frage zu stellen, diskutieren wir mit den Vahrenholts und Lünings lieber in aller Wissenschaftlichkeit über die Saugfähigkeit des Teppichs. Es würde mich nicht wundern, wenn das Schmelzen der Polarkappen eines Tages damit erklärt würde, dass nicht etwa der Klimawandel dafür verantwortlich ist, sondern der heiße Atem der Eisbären, die das intensive Herumtollen im Schnee einfach nicht lassen können.
Allen Schönrednern und Beschwichtigern der Welt sei ein Zitat des Philosophen Hans Jonas ins Gedächtnis gerufen: „Der schlechten Prognose den Vorrang zu geben gegenüber der guten, ist verantwortungsbewusstes Handeln im Hinblick auf zukünftige Generationen.“
16. Januar 2001 – ein ganz normaler Tag in Deutschland, eingebettet zwischen zwei Meldungen, die so selbstverständlich daherkommen wie der Wetterbericht. Beim Frühstück erfahren wir von einer genehmigten Nazidemonstration in Hamburg, beim Abendbrot berichtet das Heute-Journal von einem Skinhead-Attentat in Stuttgart. Die Nazis reklamierten den 27. Januar für ihren Aufmarsch, der im bundes-deutschen Kalender offiziell als Holocaust-Gedenktag geführt wird. Eine Gegendemonstration wurde untersagt. Begründung der zuständigen Behörde: Die "andere Seite" hätte ihr Anliegen zuerst angemeldet. Über das Stuttgarter Attentat, bei dem vier jugendliche Glatzköpfe einen irakischen Mitbürger auf offener Straße mit Bierflaschen krankenhausreif schlugen, heißt es, die Polizei schließe einen fremdenfeindlichen Hintergrund nicht gänzlich aus.
Wie gesagt, ein ganz normaler Tag in Deutschland. Auch für Udo Lindenberg. Er gibt sich das volle Pflichtprogramm, er leistet Öffentlichkeitsarbeit. Auf seine Initiative hin hat sich nämlich ein Troß von Bands und Schauspielern auf den Weg durch die Republik gemacht. Das spektakuläre Unternehmen will unter dem Motto "Rock gegen rechte Gewalt" in Dresden, Hamburg, Rostock und Berlin eindeutig Position beziehen in unserer lau geführten Debatte um den ausufernden rechten Terror. "Das Schweinethema droht uns allmählich über den Kopf zu wachsen", nuschelt Udo, "deshalb wollen wir die Nazischeiße endgültig beenden. Wir schicken die Glatzen auf einer Naziverabschiedungstournee in den Ruhestand."
Wir sitzen in der Bar des Hamburger Atlantic-Hotels, seinem Wohnzimmer, wie er sagt. Traumschiff-Produzent Rademacher ist da, Otto Sander auch, Veronica Ferres huscht durch die Halle und Mario Adorf checkt gerade ein. Udo runzelt die Stirn und läßt die Hutkrempe vor der Sonnenbrille auf und ab hüpfen. "Wir garantieren richtig gutes Entertainment ", sagt er, "schließlich sind wir nicht von der Firma `Tief Betroffen`. Lieber mal leicht bekifft und leicht besoffen, als dauernd schwer bedrückt. Das wird eine Supershow, aber nicht nach amerikanischem Muster. Ein bißchen Freestyle auf der Bühne muß schon sein."
Eine ältere Dame nähert sich schüchtern und bittet um ein Autogramm. "Für Ihre Tochter?" fragt Udo. "Nein," lacht sie, "für mich." Während er in das dargereichte Notizbuch kritzelt, gesteht sie ihm, wie phantastisch er auf dem gestrigen Zeitungsfoto ausgesehen hätte, das ihn auf einem Berliner Ball in Gesellschaft des Kanzlerehepaars zeigte. Ob der Schröder symphatisch sei, will sie wissen. "Der ist okay", sagt er, "für`n Politiker schwer in Ordnung."
"Er ist okay", wiederholt er lächelnd, nachdem die Dame gegangen ist. "Aber wirklich beeindruckt war ich von Doris. Die Lady hat Stil und Stolz. Wir haben beschlossen, zusammen einen Song aufzunehmen, darauf freue ich mich." Er verschwindet für einen Moment an den Kamin, um in Ruhe zu telefonieren. Dabei rutscht er soweit in die Polster eines Sessels, daß nur noch der Hut über die Rückenlehne ragt.
Ich kenne Udo Lindenberg seit mehr als zwanzig Jahren. Nicht gut, aber auch nicht schlecht. Wir sind uns zu vorgerückter Stunde immer mal wieder in gähnend leeren Bars begegnet – meist standen wir bei einem letzten Tequilla wortlos nebeneinander, zwei Melancholiker, die in grober Selbstüberschätzung das Gewicht der Welt auf ihre Schultern geladen hatten und nun unfähig waren, dem neuen Tag ins Auge zu blicken. Wir hatten aber auch beruflich miteinander zu tun. Bei diesen Gelegenheiten lernten wir uns von der diziplinierten Seite kennen. Daraus ist Symphatie und Respekt erwachsen, weit entfernt von jeder Kumpanei.
Da sitzt sie also unterm Hut, die alte Nöle. Niemand außer Joseph Beuys hat sein öffentliches Erscheinungsbild über Jahre hinweg derart konsequent stilisiert. Eine Marotte geriet zum Markenzeichen und bewehrte sich gleichzeitig als Schutzschild. Schon in den siebziger Jahren, als Robert Lemke die Nation noch beim heiteren Beruferaten vor dem Bildschirm versammeln konnte, muß Udo geahnt haben, welche gewaltigen und zerstörerischen Zähne der Medienmaschine eines Tages wachsen würden. Inzwischen sind sie ihr gewachsen. Die Medien sind zum Haifisch der Entertainmentgesellschaft geworden, sie machen Stars und sie zerstören Stars. Und das in immer kürzer werdenden Abständen, ganz wie der schnelle Markt es verlangt.
An dem Mann mit dem Hut aber haben sie sich übernommen. Selbst als sie ihn vor einigen Jahren nach einem Gelage mit Harald Juhnke hier in der Atlantic-Bar zum Buhmann der Nation stempelten, weil der Altmeister des Kampftrinkens anschließend kollabierte, zielte die Attacke ins Leere. Udo konterte den Vorwurf, er sei mit der Schwäche eines Alkoholkranken nicht verantwortungsvoll genug umgegangen, auf seine Weise: "Man kann doch jemanden, der gerade einen gekonnten Absturz inszeniert, nicht in die Parade fahren", gab er zu Protokoll. Mittlerweile scheinen die Medien mit dem unverwüstlichen Popstar ihren Frieden geschlossen zu haben. Mittlerweile ist es schon eine Schlagzeile wert, wenn er in der Öffentlichkeit die Sonnenbrille abnimmt. Das tut er laut Bild-Zeitung nämlich nur alle hundert Jahre.
"Tschuldigung", sagt er, als er zurückkommt, "hat ein bißchen länger gedauert." Er nimmt die Sonnenbrille von der Nase. "Das einzige, was die braune Kloake auf Dauer eindämmen kann, ist eine bunte Republik", sagt er, "das geht mit der neuen Regierung, die ist ganz anders drauf. Zu Kohl-Zeiten war man ja Welten auseinander."
In dem veränderten Klima der rot-grünen Regierung hat sich die Zahl der rechtsextremen Terrorakte aber verdeifacht. Justiz und Polizei gehen in der Regel nach wie vor sehr pfleglich mit bekennenden Neo-Nazis um. In Talkshows werfen Sozialwissenschaftler mit mildernden Umständen für marodierende Jugendbanden nur so um sich. Und an den Stammtischen wie in vielen Wohnstuben findet ein ideologischer Schulterschluß zwischen den Generationen statt, der ein Unrechtbewußtsein bei jugendlichen Neonazis gar nicht erst aufkommen läßt.
Was also macht Udo Lindenberg so sicher, daß die braune Saat, die ja erst am Anfang ihrer Blüte steht, so ohne weiteres in sich zusammenbrechen wird? Faschismus ist keine Ideologie, die sich mit dem Verstand bekämpfen ließe, Faschismus ist geballte, unkontrollierte Energie, die sich aus dem Bodensatz einer Gesellschaft entwickelt, sobald sich dort die Erkenntnis verdichtet, daß es im Leben sowieso nichts mehr zu gewinnen gibt. Die gnadenlose Leistungsgesellschaft unserer Tage produziert genügend Verlierer, die in dumpfer Reflexion ihrer Situation bereit sind, sich zu solidarisieren und die Schuld für ihr Scheitern bei anderen zu suchen. Mit bekennenden Rockkonzerten ist da wenig zu machen.
"Hardcore-Nazis kann man nicht bekehren", bestätigt Udo, "aber es gibt viele irritierte Wanderer im braunen Sumpf, denen man die Möglichkeit zum Ausstieg geben muß. Die Leute, die in Leipzig auf die Straße gegangen sind, wollten sich die Nazischeiße bestimmt nicht einhandeln. Die sind nur reichlich durcheinander zur Zeit. Wir wollen auf dieser Tournee auch in die sogenannten NBZs gucken, in die `National befreiten Zonen`. Wo die Bürgermeister sagen, was wollt ihr denn, ist doch alles ruhig bei uns, hier passiert nichts. Da passiert nichts, weil sich keiner auf die Straße traut. Es gibt inzwischen genügend Leute in diesem Land, auch in meinem Umfeld, die sagen: notfalls fahren wir da selbst hin und geben den Nazis auf die Ohren."
Der eigentliche Grund, warum die Nazis seiner Meinung nach auf verlorenem Posten kämpfen, liegt in der entschiedenen Haltung der deutschen Wirtschaft, die nicht noch einmal den Fehler begehen wird, dem "gesunden Volksempfinden" fianziell unter die Arme zu greifen. Die großen Unternehmen schauen längst über den Tellerand des nationalen Markt hinaus, sie haben sich voll aufs Global Village konzentriert. Jede reaktionäre Bewegung in der Heimat ist Gift fürs Geschäft . "In den Vorständen der Konzerne sitzen inzwischen sehr smarte Jungs", sagt Udo. Es brauchte nicht viel Überredungskunst, um mit der Sound-Foundation von VW, der Telekom, BMW und Bertelsmann vier potente Sponsoren zu finden, die für die Kosten des rockigen Politspektakels aufkommen würden.
Ebenso wenig Überredungskunst brauchte es, die Künstler zu rekrutieren, obwohl sie für ihren Auftritt keinen Pfennig Gage zu erwarten haben. Die Liste der Teilnehmer, die sich in wechselnder Zusammensetzung dem Publikum präsentieren, liest sich wie ein Wunschkonzert. Von den siebziger Jahren bis heute ist alles aufgeboten, was der deutschen Pop-Kultur auf die Beine half. Bis auf eine Ausnahme: Marius Müller-Westernhagen. "Marius macht nicht mit", sagt Udo, "das finde ich total daneben. Er ließ mir über seinen Manager ausrichten, daß er nicht dabei sein will. Er war nicht einmal bereit, unseren Aufruf gegen rechte Gewalt zu unterschreiben. Ich hatte ihn immer für einen integren Vogel gehalten, aber nach dieser Geschichte ist er für mich gestorben."
Ende einer Freundschaft. Prätentiöses Divagehabe schön und gut, aber bitte nicht zum falschen Zeitpunkt. Die Hutkrempe bewegt sich wieder auf und ab, als wolle er dem strapazierten Hirn Luft zufächern. Zehn Jahre bevor Marius mit der an den Haaren herbeigezogenen Botschaft "Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz" seinen ersten Hit landete, hatte Udo mit dem Song "Ganz egal" bereits gegen die Diffamierung von Schwulen Partei ergriffen. Er hat sich von Anfang an für seine Ideale ins Zeug gelegt. "Das ging schon los, als ich noch ein kleiner Trommler war. Damals habe ich viel mit Schwarzen gearbeitet, die mir von der Bürgerrechts-bewegung erzählten. Ich habe mir gesagt, Entertainment allein genügt nicht, man muß eine Haltung damit verbinden. Und deswegen mag ich meinen Beruf auch nach dreißig Jahren noch so richtig gern. Weil er eben mehr kann, als ein bißchen Trallala abzusondern, das die Musikindustrie der notleidenden Welt als dekoratives Sedativum um den Hals hängt."
Udo Lindenberg und sein Panik Orchester werden die einzigen sein, die auf der Tournee "Rock gegen rechte Gewalt" in allen vier Städten auftreten. Schlappe zwanzig Minuten, mehr nicht diesmal. Aber diese zwanzig Minuten werden ausreichen, um seine unglaubliche Bühnenpräsenz unter Beweis zu stellen. Auf der Bühne ist er in seinem Element, da springt er an, da wirkt er betörend zeitlos.
"Ich spiele inzwischen eine ganz andere Rolle", nuschelt er, "man will ja nicht ewig die Rock`n-Roll-Ledermmaus geben. Jetzt sind da auch die stillen Momente. Ich erzähle den Leuten beispielsweise, wie man sich fühlt, wenn man jahrelang in dunkles Leder gehüllt mit schwerem Schritt über diese verdammten sieben Brücken gegangen ist. Der Ballast der Unwissenheit ist endlich abgeworfen. Ich habe eine sehr gute Position, mein Image erlaubt mir praktisch alles. Da bleibt viel Raum für Phantasie, das soll auch so bleiben."
Seine Sätze klingen, als würden sie durch Nordseeschlick gezogen. "Ich war immer ein Freund großer Shows", fügt er hinzu, "aber es gibt auch Situationen, wo du allein da vorne stehst, ganz ohne Schleudergitarren. Alles was du hast ist der Text und dein Bodytalk. Es gibt Leute, die vor solchen Momenten Angst bekommen." Er lacht gequält. "Aber inzwischen habe ich einen sehr speziellen schwindeligen Tanzstil entwickelt. Er ist wesentlich graziler geworden. Anfangs war das ein ziemlich unsicheres Gezottel."
1973 war es, als das Panik Orchester in der Hamburger Musikhalle zum erstenmal vor großem Publikum auftrat. Udo hatte in der Garderobe vor Nervosität fünfzehn Cola mit Korn getrunken. "Ich raste auf die Bühne, wo ich das Mikrofon auf einem dieser wackeligen Ständer wähnte. Leider hatte ich mich in der Entfernung vertan und rannte ins Leere. Ich fiel zu Boden und das Mikrofon schleuderte mir aus der Halterung direkt vor die Schnauze. Das wars dann wohl, dachte ich, die Karriere wurde soeben beendet. Plötzlich schrien die Leute vor Begeisterung auf, die dachten, das hätten wir geprobt!" Seit diesem Tag gehört die Mikrofonschleuderei zu seinem Standardrepertoire. "Sieben Meter neunzig sind nach wie vor locker drin", betont er stolz.
"Der Humor, den Udo besitzt, ist etwas, was ich in Deutschland noch nicht gefunden habe", sagte der Theaterregisseur Peter Zadek, nachdem sie 1979 gemeinsam an einer Rock-Revue gearbeitet hatten. "Er repräsentiert eine elektrisierende Mischung aus Naivität und Schizophrenie." Udo selbst erklärt das Phänomen Lindenberg gewohnt schlicht: "Ich bin von Beruf Udo Lindenberg", schrieb er in seiner 1989 erschienenen Autobiographie "El Panico". Er versteht seinen Beruf. Wer`s nicht glaubt, kann sich auf seiner Naziverabschiedungstournee davon überzeugen.
Dieses Porträt erschien in der WELT
Ach so ist das mit Sabine Christiansen: sie läßt eine andere für sich sprechen! Mit der eisernen Lady aus dem Fernsehen hat die Dame, die mich unter gleichem Namen zum Gespräch empfängt, nur in Umrissen zu tun. Auf dem Bildschirm agiert eine Frau, die mit sprödem Charme unter illustren Gästen wie eine Eisscholle im Whirlpool wirkt. Ihr holzschnittartiges Gesicht mit den flinken Augen scheint nur eines im Sinn zu haben: Die Verkörperung des unbeugsamen Journalismus.
Es gibt Kollegen, die finden das lächerlich. "Zwitscher, zwitscher? Zwatscher, zwatscher!" überschrieb die Süddeutsche Zeitung eine "grundsätzliche Würdigung der Sendung `Christiansen`." Mit solch medieninterner Eifersucht macht sich das Fernsehpublikum nicht gemein. Jeden Sonntag schauen in Deutschland mindestens sechs Millionen Menschen zu und warten darauf, dass sich die Brüderles, Merkels, Hubers und Schlauchs unbotmäßig in die Parade fahren.
Die Frau, die mir gegenübersitzt, hätte es nicht nötig, derlei Gezänk energisch zu unterbinden – sie säße einfach da und ihre weiche Ausstrahlung würde so manches rüpelhafte Benehmen im Keim ersticken. "Komme ich im Fernsehen wirklich so anders rüber?" fragt Sabine Christiansen, als wüßte sie nicht, ob sie sich über das Kompliment freuen oder ärgern soll. Fakt ist, dass (falls es sich denn um ein und dieselbe Person handelt) ihr privater und öffentlicher Auftritt nicht unterschiedlicher sein könnte.
Seis drum. Sabine Christiansen hat sich in dieser Republik zu einer Schaltzentrale des politischen Diskurses gemausert. Bundespräsident Thierse sprach vor einigen Wochen gar davon, dass unter der Reichstagskuppel weniger Politik gemacht wird als unter der blauen Kuppel an der Budapester Straße. "Das ehrt uns", sagt meine Gastgeberin lächelnd, "aber politische Entscheidungen werden immer noch im Parlament getroffen. Allerdings setzen wir so manchen politischen Diskurs einfach auf die Tagesordnung."
Sie geht zum Schreibtisch und zitiert aus einem ZEIT-Artikel: "Das Parlament, hat Wolfgang Schäuble kürzlich gedrängt, müsse wieder zum nationalen Forum, zum zentralen Ort demokratischer Debatten werden. Na Bravo! Nur schade, dass Schäuble sich einen Rückblick auf den Parlamentarismus der Kohl-Jahre verkniff. Es wäre ja wirklich zu fragen, ob es ein nationales Forum mit Sabine Christiansens Talk und Ähnlichem im Fernsehen nicht bereits gibt."
Der Artikel, den sie sich aus dem Internet gezogen hat, ist mit Unterstreichungen
und Ausrufungszeichen gespickt, als hätte sie den Autor für seine treffliche Analyse beim lesen umarmt. In ihrer Heimatstadt Kiel würde man sagen: Seht her, Kinnings,
genau das predige ich euch schon lange. "Unsere Politik wandert in die Bürgergesellschaft aus", sagt sie, "in die Konzernzentralen, an die Börsen, in die kleinen Netze oder gleich nach Europa. Das ist zum Teil gewollt, trotzdem fragt man sich immer wieder erschrocken: was haben wir da bloß wieder abgegeben? Nehmen Sie die Telekom. Wenn es früher Probleme gab, wurden die im Parlament diskutiert. Heute ist das eine Aktiengesellschaft, da hat man nichts mehr zu suchen. Die Telekom ist an die Bürgergesellschaft abgegeben worden. Dann muß diese aber auch darüber diskutieren dürfen. Und zwar mit ihren ureigenen Mitteln."
Sie blickt amüsiert aus dem Fenster. "Einst staatliche Unternehmen werden ins Privatleben entlassen", sagt sie, "der Aufstand der Anständigen wird angemahnt, Rentenvorsorge wie auch soziale Aufgaben abgegeben – alles an die Bürgergesellschaft, die sich ihrer Verantwortung durchaus bewußt ist. Das muß doch diskutiert werden! Die Politik müßte sich eigentlich darüber freuen, dass viele Themen wieder für ein großes Publikum interessant sind, die vorher in die Verantwortung des Staates abgeschoben wurden."
Keine Viertelstunde hat es gedauert, und schon schieben sich die beiden Figuren, deren Unterschiedlichkeit eben noch eklatant schien, zusammen. Das liegt an der Stimme, die immer dann zu kühler Autorität neigt, wenn sie dem Diktat des Sachverstandes folgt. Weit mehr als im Fernsehen, das ihr jede Menge moderater Pflichten auferlegt, ist Sabine Christiansen eine temperamentvolle, intelligente, streitbare Frau, die sich ihrer Bedeutung durchaus bewußt ist. Dass sie diese Bedeutung unter anderem der chronischen Bewußtseinsstörung einer Männergesellschaft zu verdanken hat, gesteht sie bedingt ein. Bedingt. Denn abgesehen davon, dass sie in dieser Männergesellschaft das Glück hat, als "Quotenfrau" Karriere zu machen, wäre sie sich ihres Erfolges auch in einer emanzipierten Gesellschaft sicher.
"Als ich 1987 bei den Tagesthemen anfing, war das der einzig wichtige Platz im deutschen Fernsehen, auf dem eine Frau agierte", sagt sie. "Gemessen an der Vielzahl von Frauen, die heute journalistisch ausgebildet werden, sind wir immer noch extrem unterrepräsentiert. Das größte Frauendefizit in den Medien gibt es in den Chefetagen, egal ob Sie die Verlage, das Privatfernsehen oder die Öffentlich-Rechtlichen nehmen. Auf dem Bildschirm darf man schon, aber bloß nicht in die Führungsspitze. Dieser Zustand spiegelt unsere gesellschaftliche Situation insgesamt wider."
Der Anteil an Frauen beträgt in den Führungsriegen Europas 8 Prozent, damit liegt
der alte Kontinent weit hinter den Vereinigten Staaten zurück. "In Deutschland sind es sogar nur knapp sechs Prozent", ergänzt Sabine Christiansen, "das zeigt sich auch
in der Zusammensetzung meiner Gesprächsrunden." Es sei an der Zeit, die männlichen Denkschablonen zu verlassen, nach denen der Ernährer morgens um acht aus dem Haus geht und spät abends nach dem letztem Termin heim kommt. "Die meisten Frauen um die vierzig haben Kinder. Arbeit läßt sich auch fließend gestalten. Es braucht nicht immer starre Sitzungszeiten, man könnte vieles den Bedürfnissen der Frauen anpassen. Aber es fehlte zu lange der Wille, Frauen über ihre Alibifunktionen hinaus wirklich zu fördern. Jetzt haben wir die Debatte."
Die Flexibilität, die sie in der Arbeitswelt anmahnt, reklamiert sie nicht für sich. Sie hat keine Kinder. Da sie Arbeit und Leben nicht trennen will, ist sie in ihrem "Medien Kontor" allgegenwärtig. 35 feste Mitarbeiter, davon zwölf Redakteure, bereiten mit ihr die Sendung vor. Sonntags wird ein technischer Stab von weiteren hundert Leuten tätig. Der Rhythmus, in dem dieser Personalkörper tickt, ist sehr unterschiedlich. Wenn Herr Leisler-Kiep der CDU am Dienstag eine Million Mark überweist, von dessen Herkunft er angeblich keine Ahnung hat, wird das Programm am Freitag umgeworfen. "Das ist der Vorteil, wenn man die Gesetze der Tagesaktualität kennengelernt hat", sagt Sabine Christiansen, "ich habe kein Problem damit, die Sendung von heute auf morgen zu ändern. Ich kann meine Kräfte gut einschätzen."
"Sabine Christiansen" hat sich in Deutschland als ein seismograhisches Forum etabliert. Was die Menschen aktuell umtreibt, von der Spendenaffäre bis zur drohenden rot-roten Koalition in Berlin – unter der blauen Kuppel an der Gedächtniskirche wird es diskutiert. Der Vorwurf, dass man dabei immer wieder den Brüderles, Merkels, Hubers und Schlauchs begegnet, trifft meine Gesprächspartnerin nicht. "Sie müssen die Entscheidungsträger und Meinungsbildner dabei haben", sagt sie, "und die bilden einen eingeschränkten Kreis. Wenn Sie die nicht dabei haben, diskutieren Sie in einem luftleeren Raum und können Ihre Fragen und Vorwürfe nie an die richtige Adresse richten."
Wer die Hand ständig am Puls der Zeit hat, läuft Gefahr, die kleinste Erregung überzubewerten. Erst wer die Souveränität besitzt, nicht auf jeden Ausschlag zu reagieren, gewinnt jenen Themen Sendezeit, die weit bedeutsamer sind, als jede Rentenreform. Die Schnelligkeit der Mediengesellschaft, hat Sabine Christiansen in einem Interview gesagt, lenke von den wesentlichen Problemen immer mehr ab. "Die Halbwertzeiten großer Themen wie Gen-Technik oder Klimakollaps werden kürzer", gesteht sie. "In den siebziger und achtziger Jahren wurde der Umweltschutz zu Tode diskutiert. Es brauchte erst die BSE- und MKS-Krise, um die katastrophalen Folgen unseres Wirtschaftens wieder ins Gedächtnis zu rufen."
In der Zeit, in der wir miteinander sprechen, sind Urwälder von der Fläche Münchens von der Erde verschwunden. Sabine Christiansen weiß das, sie ist bestens
informiert. Sie findet das schrecklich. Aber sie ist Realist genug, um einzugestehen, dass der Umweltschutz, welcher ohnehin nicht auf nationaler Ebene diskutiert
werden kann, in seiner Komplexibilität nur bedingt medienkompatibel ist. Die
Wahrheit ist den Menschen eben nicht mehr zumutbar, wie die Schriftstellerin Ingeborg Bachmann noch meinte. Das Mediengeschäft ist in erster Linie ein
Geschäft, es hat wie jedes andere mit Marktgesetzen zu tun. Infolgedessen sind die Medien weniger der Aufklärung als dem Entertainment verpflichtet.
Auch "Sabine Christiansen" ist Entertainment, sonst wäre die Sendung nicht populär. Wenn sich die Politiprominenz Sonntags fetzt ("Nun lassen Sie mich... nun lass... nun lassen Sie mich doch mal ausreden!") werden auf deutschen Couchen Unmengen von Chips verdrückt. Kritiker werfen der Moderatorin vor, dass sie dem Treiben nicht rechtzeitig Einhalt gebiete, dass sie sich überrumpeln lasse und hilflos zusehe, wie ihr Forum für Parteipropaganda mißbraucht werde.
Sie schüttelt den Kopf. "Als Moderatorin werfe ich zu Beginn der Diskussion ein Netz aus", sagt sie. "Dann geht es darum, ob ich die Knotenpunkte halten kann oder ob sich das Netz zum zerreißen spannt. Solange es eine spannende Dehnung hat, ist es wunderbar. Aber irgendwann wird die Spannung so groß, dass man die Dinge wieder zusammenführen muß. Darin sehe ich meine Aufgabe. Der Zuschauer soll merken, auf welch emotionaler, manchmal fast verletztenden, zynischen Ebene eine Debatte abläuft. Dazu muß ich das Gespräch aber laufen lassen."
Das Spannende sei, dass sie nie zuvor wisse, wie die Chemie ihrer Gäste untereinander funktioniere. Das Wort spannend oder hochspannend folgt bei Sabine Christiansen in Serie, sobald sie über ihre Sendung spricht. Sie findet es spannend, wenn sich ein Gespräch, das ruhig begann, in einer Heftigkeit aufbaut, die sie nicht erwartet hatte. Wirtschaftsgrößen zu gewinnen, die für gewöhnlich nicht an die Öffentlichkeit gehen, sei hochspannend. Aber nicht nur große Namen lockten das Publikum vor den Bildschirm, auch spannende Themen verfehlten ihre Wirkung auf die Einschaltqouten nicht.
Sabine Christiansen präsentiert sich live. Fehler und Peinlichkeiten sind nicht korrigierbar. Wie wichtig ist ihr die Anwesenheit des Studiopublikum? "Sehr wichtig", sagt sie, "das Publikum wirkt wie ein Korrektiv. Wenn jemand ausfallend wird, buhen die Leute. Das zeigt Wirkung. Viele Politiker sind versucht, Allgemeinplätze applausheischend in die Runde zu werfen. Es ist interessant zu sehen, dass dies nicht funktioniert. Die Leute merken, wenn ein Satz spekulativ für die Öffentlichkeit bestimmt ist, sie lassen sich nicht mißbrauchen."
Nicht zuletzt dieses gesunde Volksempfinden ist es, das Sabine Christiansen das Gefühl gibt, in richtiger Funktion unterwegs zu sein. Das Gewicht der Welt will sie nicht schultern, wer vermag das schon? Aber Anwalt der Zuschauer möchte sie sein. Das ist spannend. Sie war nie eine, die nur aufs Nationale geschaut hat. Dazu ist sie
zu viel gereist, dazu sind in ihrem Freundeskreis zu viele Kulturen vertreten. Unter
anderem war sie mehrmals in Tibet. Dort hat sie erschnuppert, was es bedeutet, sich dem Leben auf andere Weise hinzugeben, als unter der Glasglocke an der Gedächtniskirche. Die meditativen Übungen im Kloster machte sie begeistert mit. Wenn das Ritual morgens um drei begann, war sie dabei.
"Ich bin sehr neugierig", sagt sie, "ich lasse mich gerne einfangen. Aber nur, weil ich die zeitliche Begrenzung dahinter kenne. Ich wäre totunglücklich, wenn ich drei Wochen auf einer einsamen Insel verbringen müßte." Sie lacht. "Aber so schlimm wäre das auch nicht: wenn ich keine Arbeit hätte, würde ich mir welche machen. Ich würde die Insel in eine Arbeiststätte verwandeln, verlassen Sie sich drauf."
Es ist immer gut, wenn jemand zu der Fron steht, die ihm auferlegt ist. Warum werde ich trotzdem nicht den Gedanken los, dass diese Frau bei einem Einbruch in ein Juweliergeschäft nicht das Diamantencollier klauen würde, sondern das Samtkissen, auf dem dieses drapiert ist?
Das Porträt erschien in der Berliner Morgenpost
Der gute Ton
Framingham, Massachusetts. Hifi-Fans aus aller Welt klingeln bei der Erwähnung dieses stillen Örtchens 30 Meilen westlich von Boston die Ohren. Für sie ist die gesichtslose Ansammlung von Häusern, die sich dort unter unseren Füßen in in der Senke ausbreitet, der Inbegriff des guten Tons, das „Ohr zur Welt“. Amerikanischen Sound-Freaks reicht gar die Bezeichnung „The Mountain“, um in Verzückung zu geraten. So nämlich lautet die offizielle Postadresse der Bose Corporation. „Dieser Hügel hieß schon so, bevor wir uns hier niederließen“, sagt Amar G-Bose. Das Schmunzeln des Mannes, der in seiner Branche wie ein Guru verehrt wird, verrät, daß er die Adresse durchaus für angemessen hält. Er fand sie vor, er brauchte sie nicht einmal zu erfinden – das ist es, was ihn freut.
Wir stehen schweigend an der Fensterfront seines Büros. Bevor die Situation zur Andacht eskaliert, bricht mein Gastgeber in ein kindliches Lachen aus, das ich noch öfter von ihm hören sollte. „Als ich dreizehn war, begann ich Radios zu reparieren“, sagt er, „nachts und am Wochen-ende. Ich konnte damals alles reparieren, aber ich konnte es nicht entwickeln. Das hat mich gewurmt. Ich wollte dieses Fach unbedingt studieren. Mit 19 wußte ich schon, daß ich irgendwann eine eigene Firma haben würde, es war, als hätte man mir eine Aufsicht auf mein Leben gestattet. Mit 32 sagte ich mir, mein Gott, du weißt, daß du eine Firma haben wirst, aber du hast bis jetzt nichts dafür getan! Ich mußte förmlich in dieses Business hineingeschupst werden. Es war mein chinesicher Professor am MIT, der mir riet, mich selbstständig zu machen. Ich bin ihm sehr dankbar.“
Dankbarkeit ist ein Lieblingswort des Amar G. Bose, den das Forbes Magazin zu den reichsten vierhundert Männern Amerikas zählt. Der Sohn indischer Einwanderer hat ein Gesicht, das einem vorkommt, wie eine längst vertraute Landschaft. Vermutlich liegt es daran, daß Erfolg auch beseelt und das indisch geprägte Physiognomien dieser stillen Freude einen besonderen Glanz verleihen. „Leben ist Energie“, sagt Bose, „und Energie bedeutet Schwingung, also Klang.“ Im Grunde täte er nichts lieber, als die Urmelodie des Lebens hörbar zu machen. Ein aussichtsloses Unterfangen, sicher, aber wozu hat der Mensch Träume? Nur mit ihnen ist die Festung Realität zu knacken.
Der Mann ist siebzig – so what. Wir alle werden durch die Zeit gereicht. Aber wer wie Bose daran glaubt, daß Jugendlichkeit und Kreativität keinem Verfallsdatum unterliegen, hat kein Problem damit. Das wahre Alter läßt sich nicht in Zahlen messen, es hat zu tun mit dem Grad an energetischer Kompression, die uns antreibt. Sie ist es, die darüber entscheidet, was alles in ein Leben paßt. Das Leben des Amar G. Bose hatte immerhin Platz für den Aufbau eines Imperiums, das sich mit 5000 Angestellten zur weltweit feinsten Adresse der Hifi-Branche gemausert hat.
„Ich verfüge über eine gute Grundausstattung, ich war bereits als Kind mit einer gesunden Neugierde ausgestattet“, sagt er, „ich bin in viele Dinge verwickelt, Musik ist nur ein Aspekt.“ Wir verlassen den gläsernen Verwaltungspalast und wechseln hinüber in den flachen Pavillonbereich, in dem umgesetzt wird, was er von Anbeginn zur Firmenphilosophie erhoben hat: „Better Sound Through Research“ („Forschung sorgt für den besseren Klang“). Die Losung findet sich überall auf dem Gelände, selbst die firmeneigenen Shuttlebusse, die zwischen den Labortrakten im Tal und dem Hauptgebäude verkehren, fahren sie spazieren. Irgendetwas im Bose-Reich erinnert den unbedarften deutschen Besucher fatal an die „Schöne neue Welt“ des Aldous Huxley. Vielleicht liegt es daran, daß deutsche Firmen keine ideologischen Netze über ihre Mitarbeiter auswerfen, daß unsere Betriebe nicht danach streben, sich in den Stand einer Ersatzfamilie zu bringen.
Ein solcher Zusammenhalt muß nicht künstlich erzwungen sein. Das wird mir klar, als ich an der Seite Amar G. Boses durch die Flure seiner Firma schreite. Uns begegnet kein einziger Angestellter, der sich vor dem Chef devot verbiegt. Mein Gastgeber zeigt mir die Patente, die er in seinen frühen Jahren eingereicht hat und die damals niemanden interesierten. Mehr als hundert sind es, die er sich sorgsam hat rahmen und an die Wand hängen lassen. Sie stammen aus den späten fünfziger Jahren, als Bose am weltberühmten MIT (Massachusetts Institute of Technology) an einem Forschungsprogramm über physikalische Akustik und Psychoakustik arbeitete. 1956, so erzählt er, habe er seine erste Hifi-Anlage gekauft. Damals spielte er Violine und er war entsetzt über die Wahrnehmungs-lücke zwischen Originalton und technischer Wiedergabe. „Das elektronische Equipment kennt keinen Unterschied zwischen Lärm und Musik“ sagt er, „es geht lediglich darum, ein geräusch so originalgetreu wie möglich zu reproduzieren. Ich fühlte mich schlagartig herausgefordert.“
Er öffnet die Tür zu einem kleinen Vorführraum, in dem nichts weiter enthalten ist als ein Computer, der mit einer merkwürdigen Konstruktion aus zwei kleinen Lautsprechern verbunden ist, zwischen denen sich ein hand-großes Lederpolster befindet. „Dies ist unser Auditioner Audio Demon-stration System“, sagt er stolz, „es hat uns am Markt einen entscheidenden Vorteil gebracht. Legen Sie ihr Kinn auf das Kissen.“ Er schaltet den Computer ein, auf dessen Bildschirm die architektonische Skizze eines Kirchenschiffs erscheint. Ich lausche einem Orgelkonzert von Bach und sehe, wie sich Bose mit der Maus von einem Winkel des Gebäudes in den anderen klickt, was das Hörerlebnis jedesmal entscheidend verändert. Es kommt mir vor, als würde ich in Bewegung sein, als würde ich willkürlich durch die Räumlichkeit gebeamt. „Zehn Jahre haben wir daran geforscht“, sagt mein Gastgeber sichtlich zufrieden. „Alles was wir brauchen, ist eine architektonische Skizze. Aufgrund dieser Skizze sind wir in der Lage, jeden Sound zu simulieren, der einen später im fertigen Gebäude erwartet. Originalgetreu. Darauf geben wir Garantie.“
Als nächstes führt er mich in einen Raum, der nicht minder verblüfft, weil man in ihm partout nicht auf dem Teppich bleiben kann. Der nämlich hängt an der Wand und mit ihm die ganze Zimmereinrichtung samt Couch und Tisch. Man fühlt sich wie ein Gecko auf Wanderschaft. In dieser verdrehten Welt werden Messungen vorgenommen, um sicherzustellen, daß der angestrebte Raumklang selbst dort perfekt funktioniert, wo man seine Ohren in der Regel nicht aufstellt. Um normal Platz zu nehmen, müßte man schon schwerelos sein.
Bose hat längst gemerkt, daß mich der kleine Ausflug in die wundersame Welt der Akustik in den Bann gezogen hat. Er geleitet mich in einen Nebenraum, wo Decke und Wände ganz und gar mit einem abstrusen Schaumgummirelief verkleidet sind, dessen unterschiedlich lange Spitzen einen regelrecht zu punktieren scheinen. Wir stehen auf einem freischwebenden Rost und als sich die Tür hinter uns schließt, glaube ich aus der Welt katapultiert zu werden. Jedes Wort scheint sich augenblicklich aufzulösen, es findet keinen Halt, keinen Hall. Es nützt auch nichts, wenn man laut wird – mir ist schwindlig. Als wir endlich ins Freie gelangen und der Klang meiner Stimme wieder über die Nasenspitze hinaus reicht, verspüre ich einen unbändigen Drang nach Unterhaltung, nicht etwa wegen der Inhalte, sondern des Wohlklangs wegen, den Sprache bei jemanden auslöst, dem sie eben fast genommen wurde.
Mit Beklemmung sehe ich der nächsten Demonstration entgegen Wie sich herausstellt, ist das auch berechtigt. Amar G. Bose führt mich zum „Bunker“. Der Bunker ist die Hölle. Hinter zwei dicken Stahltüren wartet das akustische Inferno. Ohne die zuvor verabreichten Ohrstöpsel und ohne die festanliegenden Kopfhörer, würde man in diesem dröhnenden Soundgewitter zerplatzen. Wer seinen Kopf in das Triebwerk eines Jumbo-Jets steckt, kommt vermutlich gnädiger davon, als derjenige, der sich an dieser Stelle seiner Kopfhörer entledigt. Im Bunker werden dutzende von Lautsprechern der unterschiedlichsten Größe permanent auf Vollast gefahren, um ihre Lebensdauer am Limit zu testen. Einige schreien seit zwölf Jahren vor sich hin, ohne zusammenzubrechen. Bose legt meine Hand an den Ausgang eines solchen Monstrums, dessen Brüllen die Luft erschüttert. Es fühlt sich an, als versuche man einem Orkan das Maul zu stopfen. Das ist zuviel des Guten, ich will raus.
Als Lohn für erwiesene Tapferkeit zeigt mir Bose sein Auditorium, das er im Parterre des neuen Glaspalastes hat bauen lassen. Der Mann, der trotz aller unternehmerischen Verpflichtungen nie aufgehört hat, am MIT zu lehren, bittet mich, in den oberen Reihen Platz zu nehmen. Er selbst stellt sich unten an die Tafel. „Ich spreche jetzt völlig normal zu Ihnen“, sagt er, „und ich weiß, daß Sie mich gut verstehen. Dieser Raum ist so konzipiert, daß es keiner technischen Hilfe bedarf, um miteinander zu kommunizieren.“ Das Auditorium ist der Platz, in dem Bose seinen potentiellen Kunden die Geheimnisse seiner Wissenschaft offenbart. Hier saßen auch die Herren aus den Chefetagen edler Autoschmieden, für die die Bose Corporation ihre maßgeschneiderten Soundsysteme fertigt. Bose liefert nicht einfach, Bose paßt an. Die Bose-Ingenieure kennen den Innenraum eines Autos bereits, bevor es in Serie geht. Sie vermessen die Akustik der Limousinen derart exakt, daß der exzellente Klang des hauseigenen OEM-Systems (Original Equipment Manufacturer) auch auf den „billigen“ Plätzen garantiert ist. 1983 wurde dieses System erstmals eingesetzt - im Cadillac Seville. In Deutschland bieten Audi, Mercedes und Opel diese Klangqualität, die ihresgleichen sucht.
„Was ist mit BMW?“ frage ich von oben herab. „Sie sprechen zu einem Ingenieur, nicht zu einem Verkäufer“, antwortet er. „Wenn jemand unser Produkt haben will, soll er zu uns kommen. Wer nicht zu uns kommt, der ist noch nicht so weit, der hat uns nicht verdient...“ Da ist es wieder, dieses kindliche Lachen, das ich so schnell nicht vergessen werde. „Wissen Sie eigentlich, daß wir gerade einen Vertrag mit Mekka unterschrieben haben?“ fragt er. Nein, weiß ich nicht. „In Zukunft werden die islamischen Pilger mit glasklaren Gesängen und Informationen bedient“, fügt er an. „Im Grunde ist die Sache ganz einfach. Man muß die Töne nur gut verstehen können. Einen perfekten Sound gibt es nicht. Wer in den Louvre geht, kann auch nicht sagen, welches Bild das Beste ist. Eines aber habe ich gelernt: Akustik hat mehr Dimensionen, als es die Wissenschaftsparameter vermuten lassen.“
Ich steige die Treppen hinab in die erste Reihe. Ich frage ihn, ob er die Voyager-Tapes der NASA kennt, auf denen die elektromagnetischen Felder einiger Planeten unseres Sonnensystems in Töne umgewandelt wurden, die sich wie große kosmische Gesänge anhören. „Nein“, sagt er erstaunt und setzt sich neben mich, „klingt interessant.“ - „Von der Erde gibt es zwei Aufnahmen“, kläre ich ihn auf, „sie wurden im Abstand von zwanzig Jahren gemacht. Im Vergleich zur ersten Aufnahme klingt die zweite, als ob unser Planet weint...“ Er steht auf und legt kurz den Arm um mich. Der Mann hat viel zu sagen, wenn er schweigt. Hoffentlich reißt er sich zusammen, hoffentlich erfindet er in seinem jugendlichen Elan auf seine alten Tage nicht noch ein System, daß unsere Gedanken hörbar macht...
Der Artikel erschien in der Zeitschrift Auto-Forum
Die Klimakrise ist kein politisches Thema, sie ist eine moralische und spirituelle Herausforderung für die gesamte Menschheit. Sie ist auch unsere größte Chance das globale Bewusstsein auf eine höhere Ebene anzuheben.
Lester Russell Brown (* 1934) ist ein Umwelt-Analytiker und Buchautor. Er ist Gründer und Direktor des Earth Policy Institute (gegr. 2001), eines gemeinnützigen Umweltforschungsinstitutes mit Sitz in Washington, D. C., wo er auch lebt. Zuvor war er 26 Jahre lang Leiter des Worldwatch Institute, ebenfalls in Washington D.C. Brown hat zahlreiche Bücher zu Umweltthemen veröffentlicht, die in mehr als 40 Sprachen übersetzt wurden. Sein jüngstes Buch ist unter dem Titel Plan B 2.0: Rescuing a Planet Under Stress and a Civilization in Trouble im Jahre 2006 erschienen. Brown wurde von der Washington Post als „einer der einflussreichsten Denker der Welt“ bezeichnet.
Dass der deutsche Faschismus seine enorme Destruktivität entfalten konnte, hängt auch damit zusammen, dass die Mehrheit eines Volkes die Wirklichkeit, die sich vor der eigenen Haustür ereignete, ins Unbewusste abspaltete. Ähnliches wird vermutlich die kommende Generation über unser Verhältnis zu den natürlichen Ressourcen der Erde sagen.
Ingo Benjamin Jahrsetz ist Initiator und Ehrenvorsitzender des Spiritual Emergence Network e.V. (SEN) und betreibt eine Psychotherapeutische Praxis in Wittnau unweit von Freiburg im Breisgau
Ist nicht der Kollaps der industrialisierten Welt die einzige Hoffnung für den Planeten? Liegt es nicht in unserer Verantwortung hierfür zu sorgen?
Maurice Strong, Gründer des UN Environment Programme
Eine massive Kampagne muss gestartet werden um die USA zurückzuentwickeln. Zurückentwicklung bedeutet, unser wirtschaftliches System mit den Wirklichkeiten der Ökologie und der Situation der weltweiten Rohstoffressourcen auf Linie zu bringen.“
Paul Ehrlich, Professor of Population Studies
Die einzige Hoffnung für die Welt ist, zu gewährleisten, dass es nicht noch eine weitere USA gibt. Wir können es nicht zulassen, dass andere Länder dieselbe Anzahl an Autos und dieselbe Menge an Industrialisierung haben, wie wir in den USA. Wir müssen die Länder der Dritten Welt genau dort stoppen, wo sie gerade sind.
Michael Oppenheimer, Environmental Defense Fund
Wir müssen dies zu einem unsicheren und ungastlichen Ort für Kapitalisten und ihre Projekte machen. Wir müssen die Straßen und das umgepflügte Land zurückfordern, den Dammbau anhalten, existierende Dämme einreißen, eingezwängte Flüsse befreien und zur Verwilderung von Millionen von Hektar gegenwärtig besiedeltem Land zurückkehren.
David Foreman, co-founder of Earth First!
Komplexe Technologie jeglicher Art ist ein Angriff auf die menschliche Würde. Es wäre – wegen dem was wir damit anstellen könnten – fast schon desaströs für uns eine Quelle sauberer, billiger und überreichlicher Energie zu entdecken.
Amory Lovins, Rocky Mountain Institute
Die Aussicht billiger Fusionsenergie ist das schlimmste was dem Planeten passieren könnte.
Jeremy Rifkin, Greenhouse Crisis Foundation
Unser unersättlicher Antrieb tief unter der Erdoberfläche herumzubuddeln ist eine absichtsvolle Erweiterung unserer dysfunktionalen Zivilisation in die Natur.
Al Gore, ehemaliger US-Vizepräsident
All diese Gefahren werden durch menschliches Eingreifen verursacht und es ist nur durch veränderte Einstellungen und verändertes Verhalten möglich, dass sie überwunden werden können. Der wirkliche Feind ist daher die Menschheit selbst.
Club of Rome, The First Global Revolution.
„Die Menschheit ist das gefährlichste, zerstörerischste, egoistischste und unethischste Tier auf der Erde.
Michael Fox, Vice-president of The Human Society
Menschen auf der Erde sind in vielen Dingen wie pathogene Mikroorganismen oder wie Zellen eines Tumors.
Sir James Lovelock, Healing Gaia
Eine vernünftige Schätzung für eine industrialisierte Weltgesellschaft bei aktuellem materiellen Standard von Nordamerika wäre 1 Milliarde Menschen. Bei dem genügsameren Lebensstandard der Europäer wären 2 bis 3 Milliarden möglich.
United Nations, Global Biodiversity Assessment
Eine Gesamtbevölkerung von 250 – 300 Millionen Menschen, ein Rückgang um 95 % der heutigen Zahlen, wäre ideal.
Ted Turner, Gründer von CNN und einer der größten Spender der Vereinten Nationen
Ein Amerikaner belastet die Erde mehr als 20 Bangladeschis. Es ist schrecklich das zu sagen, aber um die Weltbevölkerung zu stabilisieren, müssen wir 350.000 Menschen pro Tag auslöschen. Es ist schrecklich das zu sagen, aber es ist genauso schlimm dies nicht zu tun.
Jacques Cousteau, UNESCO Courier
“Ich nehme an, dass die Ausrottung der Pocken falsch war. Die Pocken spielten eine wichtige Rolle im Ausgleich des Ökosystems.
John Davis, editor of Earth First! Journal
Die Auslöschung der menschlichen Rasse dürfte nicht nur unausweichlich sein, sondern auch eine gute Sache.
Christopher Manes, Earth First!
Alle potentiellen Eltern sollten verpflichtet sein, empfängnisverhütende Chemikalien zu verwenden. Die Regierung gibt dann Gegenmittel für Bürger aus, die für das Entbinden von Kindern ausgewählt wurden.
David Brower, first Executive of the Sierra Club
Wir brauchen etwas um die breite Unterstützung zu gewinnen, um die öffentliche Vorstellung einzufangen… Wir müssen also mit erschreckenden Szenarien aufwarten, vereinfachte, dramatische Aussagen machen und dabei wenig Zweifel äußern… Jeder von uns hat sich zu entscheiden, was die richtige Balance zwischen Effektivität und Ehrlichkeit ist.
Stephen Schneider, Stanford Professor of Climatology, lead author of many IPCC reports
Wenn wir keine Desaster ankündigen, wird uns auch keiner zuhören.
Sir John Houghton, First chariman of IPCC
Es ist egal was wahr ist, wichtig ist nur, was die Menschen glauben was wahr ist.
Paul Watson, Sea-Shephard und Co-founder of Greenpeace
Wir müssen auf dem Thema der globalen Erwärmung herumreiten. Selbst wenn die Theorie der globalen Erwärmung falsch ist, tun wir das richtige im Sinne der Wirtschafts- und Umweltpolitik.
Timothy Wirth, President of the UN Foundation
Es ist egal, ob die Wissenschaft der globalen Erwärmung komplett an den Haaren herbeigezogen ist: gibt uns der Klimawandel doch die größte Möglichkeit Gerechtigkeit und Gleichheit in die Welt zu tragen.
Christine Stewart, former Canadian Minister of the Environment
Die einzige Art unsere Gesellschaft wirklich zu verändern, ist den Menschen mit einer möglichen Katastrophe Angst zu machen.
Emeritus professor Daniel Botkin
Wir stehen an der Schwelle einer globalen Transformation. Alles was wir hierzu brauchen ist die richtige Krise.
David Rockefeller, Club of Rome executive manager
Der Klimawandel wird zu einer Katastrophe führen, die weltweiten Meereshöhen werden um 7 Meter steigen. Dann heißt es Bye Bye für die größten Teile von Bangladesh, den Niederlanden und Florida. London würde zum neuen Antlantis.
Greenpeace International
Der Klimawandel ist real. Er ist nicht nur real, sondern hier. Seine Auswirkungen führen zum Aufstieg eines angsterregenden neuen globalen Phänomens – der menschlich verursachten Naturkatastrophe.
Barack Obama, US-Präsident
In der Natur folgt das natürliche Wachstum einem Masterplan, einer Blaupause. Solch ein „Masterplan“ fehlt uns beim Wachstumsprozess und der Entwicklung des Weltsystems. Es ist jetzt an der Zeit einen Masterplan für nachhaltiges Wachstum und Entwicklung zu entwickeln, der auf einer globalen Bündelung aller Ressourcen und einem neuen globalen Wirtschaftssystem beruht. In 10 oder 20 Jahren wird es vielleicht zu spät dafür sein.
Club of Rome, Mankind at the Turning Point
Das Konzept der nationalen Souveränität ist ein unveränderliches, in der Tat heiliges Prinzip der internationalen Beziehungen gewesen. Es ist ein Prinzip, welches nur langsam und zurückhaltend den neuen Notwendigkeiten einer globalen Umweltkooperation weichen wird.
UN Commission on Global Governance report
Demokratie ist kein Allheilmittel. Sie ist nicht in der Lage alles zu organisieren und sie ist sich ihrer eigenen Grenzen nicht bewusst. Diesen Fakten müssen wir offen ins Augen schauen. So frevelhaft es sich auch anhören mag, Demokratie ist nicht länger für die vor uns liegenden Aufgaben geeignet. Die Komplexität und die technische Natur vieler unserer heutigen Probleme erlaubt es nicht immer, dass gewählte Vertreter zur rechten Zeit kompetente Entscheidungen treffen.
Club of Rome, The First Global Revolution
Meiner Ansicht nach, nach 50 Jahren Dienst im System der Vereinten Nationen, gibt es die dringende und absolute Notwendigkeit einer ordentlichen Weltregierung. Es gibt keinen Hauch eines Zweifels daran, dass das aktuelle politische und wirtschaftliche System nicht mehr angemessen ist und zum Ende der Evolution des Lebens auf diesem Planeten führen wird. Wir müssen daher unbedingt und umgehend nach neuen Wegen Ausschau halten.
Dr. Robert Muller, UN Assistant Secretary General
Die Erde ist buchstäblich unsere Mutter, nicht nur weil wir von ihrer Nahrung und ihrem Schutz abhängig sind, sondern vielmehr weil die menschliche Rasse durch sie im Leib der Evolution geformt wurde. Unser Heil hängt von unserer Fähigkeit der Schaffung einer Naturreligion ab.
Rene Dubos, Vorstandsmitglied Planetary Citizens
Die effektive Ausführung der Agenda 21 wird eine profunde Neuorientierung der gesamten Menschheit verlangen, so wie sie die Welt noch nie gesehen hat – eine große Veränderung der Prioritäten bei Regierungen wie auch dem Einzelnen und einer bisher noch nicht dagewesenen Umverteilung von Finanzmitteln. Diese Veränderung wird es abverlangen, dass die Sorge über die Umweltkonsequenzen einer jeden menschlichen Aktion in die individuellen und kollektiven Entscheidungen auf jeder Ebene integriert wird.
UN Agenda 21
Unsere Zukunft klingt nach Katastrophe. Wir sind jung, kommen aus unterschiedlichen politischen Strömungen und vertreten eine Generation, die selten eine Stimme hat. Eine Generation, die einen ausgebeuteten Planeten erbt, mit sozialer Ungerechtigkeit und gigantischen Schuldenbergen. Eine Generation, die an den Folgen eines kurzsichtigen Finanzkapitalismus leidet und die Krise der europäischen Idee erlebt. Unsere Zukunftsmusik klingt nach Klimakatastrophe, Bildungsnotstand und Schuldenorgien, all dies auf Kosten von – uns.
Wir nehmen die herrschende Kurzsichtigkeit nicht mehr länger hin. Vor einiger Zeit wurde in dieser Zeitung behauptet, unsere Generation hätte kein Interesse an politischer Partizipation, wir seien hilflos und warteten darauf, dass uns jemand abhole. Wir sind nicht hilflos, und wir holen uns selbst ab. Über Parteigrenzen hinweg eint uns elf die Sorge um unsere Zukunft und der Wille zur Veränderung. Mit diesen zehn Punkten kämpfen wir für unsere Zukunft.
1. Demokratie
Das Vertrauen in die etablierte Politik bröckelt. Darunter leidet die Legitimation unserer Demokratie. Über den Wahlzettel hinaus fehlen Möglichkeiten zur Mitsprache. Die Möglichkeit zu Volksentscheiden auf Bundesebene ist genauso überfällig wie die Möglichkeit, das Entstehen von Gesetzestexten in Ministerien nachzuvollziehen und online beeinflussen zu können. Auch die Parteien müssen mehr Mitbestimmung wagen, beispielsweise durch internetbasierte Werkzeuge wie Liquid Feedback, Mitgliederentscheide und Vorwahlen. Wir wollen ein Wahlrecht ab 16 Jahren und mehr politische Bildung an den Schulen. Ein Zukunftsrat junger Menschen soll zusätzlich als Sprachrohr der jungen Generation Impulse für die gesellschaftliche Debatte setzen. Wir wollen mehr Einfluss bei den Steuermitteln: Jeder sollte mit der jährlichen Steuererklärung angeben können, in welches Ressort sie oder er einen kleinen Prozentsatz der Einkommensteuer investieren will.
2. Transparenz
Politische Entscheidungen müssen nachvollziehbar sein. Bürger brauchen die Möglichkeit, alle Akte der demokratischen Entscheidungsfindung einzusehen, sofern keine personenbezogenen Daten betroffen sind. Die bestehenden Transparenzgesetze müssen nach dem Hamburger Vorbild verbessert werden: Wer mit dem Staat Verträge macht, muss diese offenlegen. Der Lobbyismus braucht Schranken: Wir fordern ein Lobbyregister nach amerikanischem Vorbild. Nebeneinkünfte von Abgeordneten müssen detailliert offengelegt werden.
3. Internet
Debatten brauchen öffentliche digitale Räume. Wir setzen uns daher gegen Zensur, für einen Rechtsanspruch auf Zugang zum Internet, den Ausbau von Breitbandverbindungen in ländlichen Gebieten und gesetzlich verankerte Netzneutralität ein. Die digitale Privatsphäre muss besser geschützt werden.
4. Arbeit und Rente
Arbeit muss fair bezahlt werden. Die prekären Arbeitsverhältnisse der Gegenwart schaffen die Altersarmut der Zukunft. Wir Jüngeren müssen die Renten der heute älteren Generation finanzieren, werden aber später selbst nicht von ihr leben können: Der Generationenvertrag ist gebrochen. Statt die solidarische Rentenformel zu demontieren, sollen Alt und Jung sowie Reich und Arm die Lasten des demografischen Wandels teilen. In einem demokratischen Gemeinwesen darf sich niemand aus der Solidarität stehlen. Daher müssen alle Berufsgruppen – auch Beamte und Selbstständige – in einen gemeinsamen Rententopf einzahlen.
5. Staatsfinanzen
Wir erben einen gigantischen Schuldenberg und investieren bald jeden vierten Euro in die Finanzierung der Zinsen. Dieser Trend muss aufgehalten werden! Wir müssen fragwürdige Steuerfluchtmöglichkeiten konsequent abbauen, Steuerbetrug härter ahnden und eine Finanztransaktionssteuer einführen. Durch kluges Sparen an den richtigen Stellen werden Mittel frei für Kinderbetreuung, Bildung und den demografiefesten Umbau der Infrastruktur. Auf europäischer Ebene bedarf es Schritte, um die Haushalte zu konsolidieren und dafür zu sorgen, dass Banken nicht mehr nach dem Prinzip »too big to fail« mit Steuergeld gerettet werden müssen.
6. Umwelt
Wir fordern eine nachhaltige Lebensweise. Das Staatsziel Umweltschutz im Artikel 20a des Grundgesetzes muss verschärft werden, um zu verhindern, dass der Umweltschutz Leidtragender politischer und wirtschaftlicher Konkurrenzkämpfe wird. Der Artikel muss künftig Pflichten enthalten, die als subjektive Rechte gerichtlich eingefordert werden können. Die Energiewende hin zur vollständigen Nutzung von erneuerbaren Energien muss bis 2050 geschafft werden.
7. Bildung
Wir wollen erstklassige Bildungschancen von der frühkindlichen Betreuung bis zum Studium – für alle, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern. Und: In einer europäisierten und globalisierten Welt haben 16 Schulsysteme nur noch wenig Sinn. Die Länder müssen Kompetenzen in der Bildungspolitik an den Bund abgeben.
8. Familie und Geschlechtergerechtigkeit
Alle Menschen haben ein Recht auf Chancengleichheit. Kinder dürfen keinen finanziellen Ruin oder das Ende der Karriere bedeuten. Das Ehegattensplitting ist Geschichte! Unterstützt Familien mit Kindern und erkennt die Verantwortung der Wirtschaft. Kitas statt Boni: Große Unternehmen müssen gesetzlich verpflichtet werden, eine Kinderbetreuung einzurichten. Befreit, was frei ist: Die »eingetragene Lebenspartnerschaft« soll alle Rechte und Pflichten der Ehe erhalten.
9. Europa und Integration
Europa braucht mehr Demokratie! Wir fordern ein legislatives Initiativrecht für das Europäische Parlament und eine von ihm gewählte Kommission. Das Zusammenleben in der EU wollen wir stärken, etwa durch bessere europaweite Anerkennung von Studien- und Ausbildungsabschlüssen und -zeiten. Wer bei uns lebt, gehört zu uns. Wir brauchen frühkindliche Sprach- und Bildungsförderung, interkulturelle Kompetenzen im öffentlichen Dienst und offene Angebote zur Einbürgerung wie die doppelte Staatsbürgerschaft. Eine Leitkultur lehnen wir ab, denn unser Europa lebt von der gleichberechtigten Teilhabe aller hier lebenden Menschen und ihren unveräußerlichen Menschenrechten.
10. Jung und Alt gemeinsam!
Alle Generationen müssen zusammen und nicht gegeneinander arbeiten. Lasst uns mehr Patenschaften und Partnerschaften für junge Menschen in Schule, Ausbildung und Studium initiieren. Wir fordern auch die Älteren auf, vor Ort für Mehrgenerationenhäuser und Formen des solidarischen Zusammenlebens zu kämpfen. Investiert in die Zukunft statt in Kreuzfahrten!
Es liegt an uns, den Wandel nicht einfach hinzunehmen, gleich einem Sturm, der über uns hinwegfegt. Wir müssen selbst aktiv werden: in den Parteien, den Unternehmen, der Zivilgesellschaft. Denn wir haben eine gemeinsame Mission. Wir müssen Verantwortung übernehmen für das bedeutendste Projekt unseres Lebens: die Zukunft.
DIE UNTERZEICHNER
Teresa M. Bücker, 28, Autorin, SPD; Sascha Collet, 29, Bundesgeschäftsführer Die Linke.SDS; Wolfgang Gründinger, 28, Autor, SPD/Piraten; Vincent-Immanuel Herr, 24, Euphrates Institute, Student, parteilos; Sebastian Jabbusch, 29, Journalist, Piraten; Diana Kinnert, 21, Studentin, CDU; Lamia Özal, 23, Deukische Generation e. V., Studentin, parteilos; Leslie Pumm, 19, Auszubildender, FDP; Hanna Sammüller, 29, Doktorandin, Grüne; Jacob Schrot, 22, Student, CDU; Martin Speer, 26, selbstständig, Grüne
Die Website der Initiative: www.daszukunftsmanifest.de
Jürgen Hunke hatte vorgeschlagen, an die Ostsee zu fahren. Er besitzt ein Haus am Timmendorfer Strand, von dort startet er häufiger zu ausgedehnten Spaziergängen, wenn ihm nach inspirierenden Gesprächen zumute ist. Henning Voscherau ist nur einer aus der Schar derer, die sich dort an der Seite dieses umtriebigen Mannes den Wind um die Nase wehen ließen, während sie von ihm mit phantastischen Ideen gefüttert wurden.
Mein Gastgeber hat den Bentley aus der Garage geholt, schwarz, rotes Leder, fünfhundert PS. Wir gleiten wie in einer Raumkapsel über die Autobahn. „Was bedeutet für euch Journalisten eigentlich das Wort schillernd?“ fragt er unvermittelt. „Ich werde seit Jahren mit diesem Attribut versehen.“ Schillernd bedeutet schillernd, denke ich, was denn sonst? „Was ist das Gegenteil von schillernd?“ hakt er nach, als mir keine Definition einfallen will. „Stumpf“, sage ich. „Ach so, dann ist das ja positiv!“
Es dauert einige Minuten, bis man bereit ist, Hunke diesen liebenswert naiven Part abzunehmen, aber dann fällt es relativ leicht. Der Mann spricht ohne Unterlaß, seine kräftige Stimme steht wie ein unbezwingbarer akustischer Wall im Raum. Eine klassische Ge-sprächsführung ist nicht möglich. Aber man kann seinen Redefluß durch Stichworte steuern, die nimmt er virtuos auf. Jürgen Hunke spricht ohne Netz und doppelten Boden. Von Gesprächsdiplomatie keine Spur. Das läßt sich auch als Vertrauensbeweis werten, zumal er mir auf der Überholspur en passent zu verstehen gibt, daß er durchaus zu schweigen imstande ist, sobald er merkt, daß er im Begriff ist, Perlen vor die Säue zu schmeißen.
Stichwort Erfolg. „Diejenigen, die ausschließlich den finanziellen Erfolg anstreben, werden schnell verbissen, die sind nicht locker“, sagt er. „Das Wichtigste ist, daß man an einer Sache Freude hat. Dann ist es in der Marktwirtschaft eigentlich üblich, daß man mit wirtschaftlichem Erfolg belohnt wird. Ich hab nie das Materielle gesehen. Meine Grundphilosophie lautet: Nur wer den Mißerfolg liebt, wird auch Erfolg haben. Es gibt keinen Erfolg ohne Mißerfolg. Man muß viel ausprobieren, testen, dann ist beides im Programm. Allerdings braucht es immer drei Dinge: Fleiß, Kontinuität und Charakter.“ Wie ist das für ihn, Charakter? „Geben und nehmen müssen im Einklang sein. Wer dieses Gesetz respektiert, hat Charakter.“
Der Bentley beschleunigt auf 250, die Herrschaften in den zurückbleibenden Familienkutschen atmen wie Flundern, die man kurzfristig trocken gelegt hat. Jürgen Hunke widmet der Straße nicht mehr Aufmerksamkeit als zuvor. „Ich bin extrovertiert und konservativ“, höre ich ihn sagen, „diese Mischung ist gar nicht so schlecht. Man kann aber nur extrovertiert leben, wenn alles andere in Ordnung ist. Das Fundament ist die Ordnung, die Steuern müssen am besten schon gestern bezahlt sein...“
Nimmt der „schillernde“ Hunke etwas von seinen liebgewordenen „Verrücktheiten“ zurück, wenn er sich in exponierte gesellschaftliche Positionen begibt, wie 1990 als HSV-Präsident und im letzten Wahlkampf als Spitzenkandidat der STATT-Partei? „Genau das tue ich eben nicht“, antwortet er, „das ist es ja, was immer wieder zur Kritik führt. Viele in Hamburg können mit meiner Art nicht umgehen. Inzwischen läßt man mir meinen Bentley, meinen Ferrari und all das. Diese Akzeptanz muß man sich aber hart erkämpfen, das kriegt man nicht in zwei Jahren geregelt, da muß man erst durch ein Stahlbad von Neid und Mißgunst gehen. Aber das macht Spaß. Ich kann mich in dieser Stadt bewegen wie ich will, ich kann zu einem Lindenberg-Konzert gehen oder nach St.Pauli. Bei einem geschliffenen Hanseaten fragt man doch sofort: `Was macht der denn da?`.“
Warum nur verdächtige ich Jürgen Hunke, daß er sich gelegentlich in die eigene Tasche lügt, daß er unmöglich die Kraft haben kann, sich so dauerhaft souverän mit dem etablierten Mittelmaß anzulegen, das uns nun einmal umgibt? Er tut so, als sei er eine verläßliche Größe, die berechenbar einzusetzen ist im absurden Kräftespiel der unterschiedlichsten gesellschaftlichen Interessen. Ist er nie in eine dieser klassischen Fallen gelaufen, die das Leben für sensible Seelen bereit hält? In eine fatale Liebesgeschichte zum Beispiel, welche auch dem tatkräftigstem Macher beizeiten das Mark aushöhlen kann? „Liebe ist für mich ein separates Thema“, sagt er lachend und es klingt, als versage er sich bewußt jeden Gedanken an die Gefahren, die mit ihr verbunden sind. „Dieses Leiden an der Liebe, das habe ich nie kennengelernt, aber das kann ja noch kommen. Meine Tochter will mich auch immer an diesem Punkt packen. Ich bin in dieser Angelegenheit wohl etwas cooler als andere, ich setze sehr stark den Verstand ein. Frauen mögen das nicht so gern. Vor drei Wochen habe ich eine sehr hübsche junge Dame in Wien getroffen. Wissen Sie, was die zu mir gesagt hat? Du bist mir viel zu alt! Da hab ich gedacht, Junge, sie hat recht, jetzt mußt du noch bewußter leben, noch sparsamer mit deiner Zeit und mit deiner Energie umgehen.“
Wir sind da, vor uns liegt sein strahlend weißer buddhistischer High-Tech-Tempel, der am Ort schon für genügend Furore gesorgt hat. Inzwischen haben sich die Timmendorfer daran gewöhnt, sie sind sogar ein wenig stolz auf diese Sehenswürdigkeit am Strand, die keinen Spaziergänger unbeeindruckt läßt. Das Haus hätte eine Beschreibung verdient, aber es verströmt soviel Privatatmosphäre, daß man sich von ganz alleine verpflichtet fühlt, sie zu schützen.
Die Ostsee glitzert gekräuselt in der grellen Sonne. Der Tag trägt den ersten Anflug von Frühling in sich, vielleicht ist es dies, was eine ältere Dame im Vorübergehen ermutigt, Jürgen Hunke zu sagen, was für ein schöner Mann er ist. Der schöne Mann reagiert sichtlich irritiert, er war gerade dabei, über den HSV zu sprechen, dem er ja wieder „zur Verfügung“ stehen will, wenn der Verein in die zweite Liga absteigt, woran er nicht im geringsten zweifelt. „Dann wird es richtig schwer“, sagt Hunke, nachdem er sich von dem Kompliment einigermaßen erholt hat, „dann geht es in erster Linie darum, Geld zu besorgen. Heute muß man einen Fußballver-ein wie ein Unternehmen führen. Uwe Seeler kann das nicht, der muß sich auf andere Leute verlassen, die ihn anschieben. Damals hatte ich mich ja ungeliebt gemacht, als ich den Kauf der Ostimmo-bilien kritisierte. Aber so ein verein gehört doch nicht drei Leuten, er gehört der ganzen Stadt. Der HSV hat schon unter Klein den Anschluß verpaßt. In der zweiten Liga wird es richtig Probleme geben. Der nächste, der das macht, muß wissen, daß er eigenes Geld mitzubringen hat. Und ich wette mit Ihnen, daß alle, die heute in der Verantwortung sind, wegrennen werden.“
Jürgen Hunke bezeichnet sich gerne als Fußballverrückten, aber das allein kann nicht der Grund dafür sein, daß er bereit ist in die Bresche zu springen, wenn andere das Weite suchen. Den Nieder-gang des HSV interpretiert er im Kontext einer Entwicklung, die im Begriff ist, ganze Hamburg mit einem Provinzmief zu überziehen. „Vielleicht bin ich nur ein naiver Idealist“, sagt er, „aber wenn ich daran denke, das unsere Väter in ungleich schwereren Zeiten Opernhäuser, Theater und Sportstätten hingestellt haben, will mir nicht in den Kopf, daß wir in der erfolgreichsten Zeit Deutschlands nichts anderes im Sinn haben, als diese wieder zu schließen oder verkommen zu lassen. Das ist Kulturfrevel. Ich bin zu allen bedeutenden Bauträgern dieser Stadt gegangen und hab gesagt, Kinder, ihr habt Millionen, wenn nicht Milliarden an Bodenspekulationen verdient, nun gebt der Stadt doch endlich etwas zurück, bildet einen Pool, baut die Arena. Da hab ich mir nur die Nase eingehauen. Ich kriege Sodbrennen, wenn ich daran denke...“
Die Erfahrung mit den Hyperreichen der Stadt schmerzt Hunke umso mehr, da er von der Politik ohnehin keine Impulse erwartet. „Diese Stadt ist seit jeher eine sozialdemokratische Stadt. Die Hamburger SPD ist keine Intellektuellenpartei, sondern eine Arbeiterpartei, die ihre Schwerpunkte in den sozialen Fragen hat. Sie übernimmt vielleicht ein bürgerliches Thema, mehr nicht. Sport und Kultur sind bürgerliche Themen für sie. In Hamburg hat man sich für die Kultur entschieden. Der Sport bleibt auf der Strecke. Es ist tödlich, wenn keine Infrastruktur geschaffen wird, die Lebens-qualität bedeutet. Manchmal habe ich das Gefühl, die Stadt ist auf das Jahr 2000 nicht vorbereitet. Warum baut man die Arena nicht auf dem Heiligengeistfeld? Ich kämpfe seit zehn Jahren für diese Idee. Laßt uns doch etwas Solitäres bauen, etwas, das unseren Kindern zeigt, daß auch wir über eine eigene Handschrift verfügen.“
Viel Zeit gibt sich Jürgen Hunke nicht, um sich wie gewohnt einzumischen. Ende `99 will er sich aus dem Geschäftsleben zurückziehen. Sein Versicherungsimperium „Zeus“ hat er per Optionsvertrag einem Schweizer Konzern in Aussicht gestellt. „Ich möchte im nächsten Jahrtausend nicht mehr für Geld arbeiten. Welche Men-schen konnten das je so entscheiden? Zu sagen, in dem einen Jahrtausend habe ich für Geld gearbeitet, im nächsten Jahrtausend arbeite ich aus Spaß.“ Er steuert auf ein Cafe zu, das eine Kartof-felsuppe kredenzt, nach der man süchtig werden kann, wie er sagt. „Ich möchte manchmal auch jemanden eins auswischen, der mir nicht korrekt gekommen ist, das würde durchaus meinem Wesen entsprechen“, sagt er unvermittelt, nachdem die Terrine leergeputzt ist, „aber ich sage immer, was du pflanzt, wirst du ernten, im positiven wie im negativen Sinne. Deshalb habe ich ein wenig Schiß vor unüberlegten Aktionen. Man verhält sich einfach anders, wenn man dieses Gesetz kennt.“ In dem Film „Welcome Mr. Chance“ war ein von Peter Sellers gespielter Gärtner mit dieser Lebensweisheit zum wichtigsten Berater des amerikanischen Präsidenten aufgestiegen. Jürgen Hunke ist schon zufrieden, wenn jemand einen ähnlichen Sinn für die kosmischen Gesetze entwickelt, wie er selbst.
Auf dem Weg zurück in sein wunderlich weißes Haus streift er sämtliche kommunalpolitischen Felder, auf denen er dem Hambur-ger Interessenfilz in den letzten Jahren vergeblich das Banner der Kreativität entgegenzuhalten versuchte. Die schmerzliche Nieder-lage als Spitzenkandidat der STATT-Partei bei der letzten Bürger-schaftswahl scheint ihn kuriert zu haben, zumindest scheint er nun bereit, das Trägheitsgesetz zu akzeptieren, welches jede Vision zu schlucken versteht, die ohne ausreichende Unterstützung in der Öffentlichkeit daherkommt, was wiederum dem schändlichen Treiben der Absahner Tür und Tor öffnet. Aber Hunke wäre nicht Hunke, wenn er nicht gleichzeitig einen Hoffnungsschimmer am Horizont ausmachte. „Ich weiß, daß wir uns wieder zurückentwickeln werden“, sagt er. „Wir werden wieder Bücher lesen, anstatt fernzusehen, wir werden ein Teil der Arbeitslosigkeit, die nun einmal im System liegt, abbauen, weil wir ein neues Qualitätsbewußt-sein entwickeln. Es wird wieder Schneider, Schuster und jede Menge anderer Dienstleister geben. Die eine Hälfte der Gesell-schaft wird für die andere Hälfte wieder qualitative Dienstleistungen oder Waren produzieren. Darum ist konsumieren etwas Gutes, Konsum produziert Arbeit. Der Erfolg von Jil Sander besteht nicht im Design, sondern in der Qualität der Ware. Bewußtsein zur Ware - das wird sich in vielen Bereichen entwickeln.“
Er führt mich in den von Buddhastatuen gesäumten Innenhof seines Hauses, dessen plätscherndes Wasserspiel die lärmende Welt wie selbstverständlich auf Distanz zu halten scheint. Jürgen Hunke sitzt schweigend im Stuhl, sein Gesicht wirkt konzentriert, entspannt und zeitlos zugleich. Dies ist also das Original. Die Dame hatte recht, er ist ein schöner Mann. „Ich hoffe, daß der Herrgott mich noch ein bißchen leben läßt und fit sein läßt“, sagt er ohne jede Koketterie. 55 wird er im Juni, denkt er gelegentlich daran, wie schnell so ein irdischer Zauber vergehen kann? „Hören Sie auf“, sagt er, als habe er einen elektrischen Schlag bekommen, „ich bin noch nicht soweit, daß ich mich damit auseinandersetzen will...“
Auf dem Weg nach Hamburg ist ihm jedes Thema recht außer diesem. Und so landen wir dann doch noch bei den Frauen. Sie sind wunderbar, da sind wir uns einig, ihre Energie ist unentbehrlich, aber zusammenleben mit ihnen? Das ist so ein Fall für sich. Wir lachen viel aber immer über uns selbst. „Was ich nie machen würde“, sagt Jürgen Hunke, als wir in die Rothenbaumchaussee biegen, „ich würde nie mit einer Frau zusammen ein Unternehmen leiten. Prinzipiell nicht. Das finden die natürlich ganz schlimm, wenn ich das so kategorisch sage. Aber irgendwann wenn es hart auf hart kommt im Business, fangen die an zu weinen. Das kann ich auf den Tod nicht ab. Die weinen und am Ende gibt man natürlich nach. So kann es nicht funktionieren...“ Dies war vielleicht der schönste Satz unserer seltsamen Reise an die See. Morgen früh um fünf wird Jürgen Hunke wie jeden Tag aufstehen, um sechs wird der Masseur kommen und anschließend wird er frisch gestärkt seine Energie in die Stadt katapultieren. Wie hatte er in Timmendorf gesagt? „Das Fundament muß konservativ sein. Erst dann kann ich anfangen zu spielen.“
Das Porträt erschien in der WELT
Zwei Hambürger